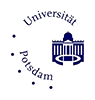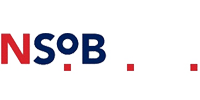Der Politikwissenschaftler Nils Bandelow analysiert die Gesundheitsreform der Großen Koalition. Die Gesundheitsreform der Großen Koalition gilt in der Öffentlichkeit als Beispiel für gescheiterte Reformpolitik. Schon vor Inkrafttreten rechneten 97 Prozent der Befragten mit steigenden Kosten für jeden einzelnen Bürger (Continentale-Krankenversicherung 2006). Auch ein Jahr nach Verabschiedung des Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-WSG) ist dessen Ablehnung in der Bevölkerung weitaus größer als die Erwartung positiver Auswirkungen (TK-Meinungspuls Gesundheit 2008; Ärzte Zeitung 27.5.2008).
1 Einleitung
Das GKV-WSG war dennoch nicht generell ein strategischer Misserfolg. Die Gesundheitsreform der Großen Koalition verfolgte parallel zwei Ziele, die in verschiedenem Ausmaß erreicht werden konnten. Die Aushandlungsprozesse verliefen teilweise in unterschiedlichen Politikarenen mit verschiedenen Akteurskonstellationen. Ebenso divergierten die Strategien für die Entwicklung, Durchsetzung und Vermittlung der beiden Reformteile. Eine Unterteilung der Analyse entlang der beiden Ziele und zwei korrespondierenden Arenen ermöglicht es, den Fall sowohl als Beispiel für eine in mehrfacher Hinsicht suboptimale Reformstrategie als auch für strategische Erfolge und Lernprozesse in der Kernexekutive zu verwenden.
Vor der Anwendung der Kriterien des Strategietools für politische Reformprozesse (SPR) erfolgt eine Darstellung der Eigenheiten des Politikfelds Gesundheit, um die Voraussetzungen für eine Übertragbarkeit von Ergebnissen auf andere Fälle zu verdeutlichen. Die anschließenden Abschnitte identifizieren auf Grundlage des SPR die strategischen Stärken und Schwächen des Reformprozesses.
Zunächst werden die wichtigsten Akteure des Entscheidungsnetzes im Hinblick auf die Voraussetzungen für eine strategiefähige Kernexekutive betrachtet. Diese Analyse schließt alle für den Reformprozess relevanten Akteure ein und berücksichtigt daher auch die Gegner einzelner Maßnahmen sowie der Gesamtreform. In den Kapiteln 4 bis 6 werden die zentralen Phasen des Agenda-Setting, der Politikformulierung und Entscheidung sowie der Politikumsetzung (soweit diese bisher – Mai 2008 – erfolgt ist) analysiert. Im Mittelpunkt steht jeweils die Frage, inwiefern sich eine durchgängige Berücksichtigung der drei strategischen Dimensionen Kompetenz, Kommunikation und Durchsetzungsfähigkeit des SPR findet. In allen drei Phasen wird zudem untersucht, ob eine effektive, bürgernahe und auf Lernbereitschaft ausgerichtete Erfolgskontrolle stattgefunden hat.
Da die Gesundheitsreform bisher noch nicht vollständig abgeschlossen ist, muss sich die Analyse der Erfolgskontrolle allerdings auf die prozessbegleitende Evaluation beschränken. Eine Betrachtung der abschließenden Erfolgskontrolle wird erst nach 2009 möglich sein, wenn alle Reforminhalte in die Praxis umgesetzt sein werden.
Die Basis der Untersuchung bilden 19 Experteninterviews mit führenden Akteuren des Reformprozesses, die im Sommer und Herbst 2007 durchgeführt wurden. Den 45- bis 90-minütigen Interviews lag jeweils ein Leitfaden zugrunde, der entlang der Kriterien des SPR entworfen wurde. Den Interviewpartnern wurde eine Anonymisierung ihrer Aussagen zugesichert. Verweise auf die Interviews enthalten daher keine Angaben zu Name und Institution des Interviewpartners, sondern jeweils nur eine neutrale Nummerierung.
Neben den teilstandardisierten Interviews wurden weitere Gespräche mit ausgewählten Akteuren auf Konferenzen und Podiumsdiskussionen geführt. Diese Ergebnisse wurden zur Validierung der gewonnenen Erkenntnisse herangezogen. Während die Interviews vor allem mit führenden Akteuren aus dem Gesundheitsministerium, dem Kanzleramt, den Regierungsfraktionen, den Regierungsparteien und ausgewählten Bundesländern geführt wurden, decken die ergänzenden Gespräche auch Akteure aus der Opposition und aus Verbänden ab. Zur Absicherung der Informationen wurden verfügbare Dokumente, Presseberichte und wissenschaftliche Analysen genutzt.
2 Grundlagen des Fallbeispiels
Gesundheitspolitik ist eine besondere Herausforderung an die Kunst des Regierens. Das Politikfeld ist selbst für Experten kaum zu überblicken. Auch die Kommunikation ist besonders schwierig: Gesundheitsminister erreichen fast schon traditionell besonders schlechte Zustimmungswerte in der Öffentlichkeit. Eine Vielzahl von Lobbygruppen und anderen Vetospielern erschwert die Durch- und Umsetzung von Reformen (Bandelow 1998). Das Politikfeld stellt somit in allen drei strategischen Dimensionen besonders hohe Anforderungen an erfolgreiche Politik. Diese besonderen Herausforderungen werden zunächst dargelegt. Im anschließenden Abschnitt 2.2 wird das GKV-WSG als zumindest partieller Erfolg strategischer Reformpolitik vorgestellt.
2.1 Gesundheitspolitik als spezifische Herausforderung für politische Strategie
Das SPR fokussiert die Analyse und Bewertung strategischer Reformpolitik auf jeweils möglichst zeitlich und inhaltlich zusammenhängende Politikprozesse. Die Gesundheitsreform der Großen Koalition kann einerseits als ein derartiger Politikprozess betrachtet werden. Andererseits ist zu beachten, dass das GKV-WSG Teil jahrzehntelanger Reformzyklen ist. Seit Mitte der 70er Jahre gibt es über 20 Gesetzespakete zur Kostendämpfung und Strukturreform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) (Bandelow 1998: 187ff.).
Die vorhergehenden Reformprozesse und Politikergebnisse beeinflussen nicht nur die inhaltliche Problemlage für die nachfolgenden Reformen, sondern verändern die Akteurskonstellationen der anschließenden Politikprozesse und prägen dabei zukünftige Wahrnehmungen, Zieldefinitionen und politische Ressourcen der Akteure.
Folglich ist es zwingend erforderlich, bei der Bewertung des GKVWSG den zeitgeschichtlichen Hintergrund der Reform zu kennen. Auch bei einer Beurteilung der Reformergebnisse ist der Hintergrund der iterativen Reformzyklen von Bedeutung. Angesichts der Historie vollständig oder teilweise gescheiterter Reformversuche verfolgen einzelne Akteure in der Gesundheitspolitik nicht nur kurzfristige inhaltliche Ziele. Die Strategien sind vielmehr auch darauf ausgerichtet, zukünftige Reformen zu erleichtern. Bei einer Beurteilung von Reformerfolgen und Misserfolgen ist dies zu beachten.
Das Krankenversicherungssystem als Teil des Sozialstaatsarrangements weist einige grundsätzliche Gemeinsamkeiten mit anderen wohlfahrtsstaatlichen Politikfeldern auf. Die gesetzliche Krankenversicherung finanziert sich über Beiträge auf den Faktor Arbeit und ist dadurch vergleichbaren Finanzrestriktionen ausgesetzt wie die Renten- und Arbeitsmarktpolitik (Bandelow 2002). Die Verbände von Kapital und Arbeit spielen eine zentrale Rolle in der Administration der politikfeldeigenen Institutionen (Bandelow 2004a).
Aus der Perspektive von Regierungsparteien bedrohen Krisen in den sozialen Sicherungssystemen den Machterhalt, da die Absicherung elementarer Lebensrisiken von den Wählern als zentrale Politikfunktion wahrgenommen wird. Dennoch unterscheidet sich das Gesundheitswesen in seinen Strukturen, Akteurskonstellationen und Problemen von den anderen wohlfahrtsstaatlichen Politikfeldern.
Im Politikfeld Gesundheit treffen multiple Interessenlagen unterschiedlicher Akteure aufeinander, woraus ein hohes Konfliktniveau bei strukturverändernden Reformvorhaben resultiert (Bandelow 1998). Die Interessenvertretungen von Ärzten, Pharmaindustrie, Krankenhäusern, Apothekern, gesetzlichen Krankenkassen, privaten Krankenversicherungen und Tarifparteien bilden ein wenig durchsichtiges, zunehmend fragmentiertes und pluralisiertes Umfeld für Reformbemühungen (Bandelow 2004a; 2007a).
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Gesundheitspolitik ist durch eine Gleichzeitigkeit von hoher Komplexität, hohem Wissensbedarf, multiplen Interessenlagen, geringer Steuerungsfähigkeit der Bundesregierung und fehlender Information in der Bevölkerung gekennzeichnet (Bandelow 1998; 2003a; 2004a; 2004b). Die Existenz starker korporatistischer Strukturen und einer ausdifferenzierten Landschaft konfliktfähiger Verbände stellt die Regierung traditionell vor große Herausforderungen bei der Gestaltung des Reformprozesses. Die Regierung muss immer in mehreren Ebenen und Themenfeldern gleichzeitig agieren (Interview 9). Eine hierarchische Steuerung sieht sich hohen Hürden gegenüber (Bandelow 2004b).
2.2 Zentrale Politikergebnisse im Kontext langfristiger iterativer Reformzyklen
Obwohl die Reformziele nicht vollständig durchgesetzt wurden und sowohl die Öffentlichkeit als auch Fachexperten Teile der Reformen grundsätzlich abgelehnt haben (Sachverständigenrat 2006), gehört das GKV-WSG, verglichen mit früheren Reformversuchen im Gesundheitswesen, zu den erfolgreicheren. Ein Reformerfolg kann bereits darin gesehen werden, dass es im Gegensatz etwa zu den blankschen Reformversuchen der 60er Jahre überhaupt zu einer Verabschiedung gekommen ist. Das Gesetz ist nicht durchgängig ein kleinster gemeinsamer Nenner, sondern beinhaltet anders als fast alle Vorgängerreformen einen grundlegenden Umbau der Organisation des Gesundheitssystems.
Die enthaltenen Strukturreformen führen zu einer nachhaltigen Veränderung des traditionellen gesundheitspolitischen Mesokorporatismus (vgl. auch Gerlinger 2008). Die körperschaftlichen Organisationen der mittelbaren Selbstverwaltung haben ihre privilegierte Rolle verloren (Interview 1). Vor allem für den ambulanten Sektor sind damit wesentliche Veränderungen verbunden. An die Stelle von Verhandlungen zwischen regionalen korporatistischen Verbänden tritt schrittweise eine neue Governanceform. Diese zeichnet sich durch zentralistische Vorgaben auf Bundesebene aus, auf die das Bundesministerium für Gesundheit wesentlich direkter einwirken kann.
Gleichzeitig wurden die Voraussetzungen für fragmentierte Selektivverträge zwischen Einzelakteuren auf regionaler Ebene geschaffen. Den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Verbänden der sieben historisch entstandenen Kassenarten (Allgemeine Ortskrankenkassen, Betriebskrankenkassen, Innungskrankenkassen, Landwirtschaftliche Krankenkassen, See-Krankenkassen, Knappschaft und Ersatzkassen) wurde durch die Reform ihre bisherige Position als faktische Vetospieler im Reformprozess genommen.
Bisher verfügten die sieben Kassenarten jeweils über eigene Verbände, die teilweise als Körperschaften öffentlichen Rechts organisiert waren. Durch die Verlagerung der wichtigsten Kompetenzen auf Bundesebene an den Spitzenverband Bund der Krankenkassen verlieren die bisherigen kassenartenspezifischen Bundesverbände ihren körperschaftlichen Status. Gemessen am Ziel der nachhaltigen Stärkung der staatlichen Steuerungsfähigkeit ist die Strukturreform daher ein Erfolg (Interview 2; Interview 6; Interview 10; Interview 11; Interview 16).
Auf der anderen Seite war das GKV-WSG in Bezug auf die Finanzierungsreform wenig erfolgreich. Das ursprüngliche Ziel einer nachhaltigen Stabilisierung der Beitragssätze wurde durch die Reform nicht erreicht. Eine Umstellung der Finanzierungsbasis ist nicht erfolgt. Das Politikergebnis stellte letztendlich einen Formelkompromiss zwischen den Konzepten einer Bürgerversicherung und einer Gesundheitsprämie dar.
Gemessen an der Abweichung vom Status quo sowie an der Differenz von intendierter und realer Reformreichweite war beim GKVWSG somit die Strukturreform vergleichsweise erfolgreich, die Finanzreform ist weitgehend gescheitert. Die Anwendung des SPR kann dazu beitragen, diesen Befund weiter zu differenzieren und die auf den ersten Blick widersprüchlichen Ergebnisse zu erklären.
3 Strategiefähige Kernexekutive: Arenen der Gesundheitsreform
Im Zentrum des SPR steht das Konzept der strategiefähigen Kernexekutive. Die Kernexekutive umfasst nicht nur formale Mitglieder der Regierung, sondern auch andere Akteure mit maßgeblichem Einfluss auf den Politikprozess. Mit dem Konzept wird somit der Tatsache Rechnung getragen, dass sich die faktischen Akteurskonstellationen und Machtverhältnisse in verschiedenen Politikfeldern und Reformprozessen unterscheiden.
Die Identifikation der wichtigsten beteiligten Akteure, die strategische Nutzung verfügbarer Informationen, die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Entscheidern und Betroffenen und die Vernetzung eines durchsetzungsfähigen Zentrums stehen daher am Anfang jeder Analyse. Bei der Gesundheitsreform der Großen Koalition wurden unterschiedliche Teilfragen in verschiedenen Entscheidungsarenen verhandelt. Im Hinblick auf die unterschiedlichen Reformerfolge erfolgt in der Anwendung des SPR eine differenzierte Beurteilung der Arena der Strukturreform einerseits und der Finanzreform andererseits.
3.1 Akteurskonstellationen in der Krankenversicherungspolitik
Angesichts der besonderen Situation der Gesundheitsreform wird zunächst die allgemeine Zusammensetzung der Kernexekutive vorgestellt. Anschließend werden die beiden wichtigsten Arenen im Hinblick auf die jeweiligen Machtverhältnisse und Interessen der zentralen Akteure analysiert.
Langfristige Grundkonstellation Die Krankenversicherungspolitik wird in besonderer Weise von der Exekutive dominiert. Insbesondere das zuständige Fachministerium – heute das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) – verfügt über herausragende eigene Ressourcen. Andere Fachministerien und auch das Bundeskanzleramt können dagegen in der Regel nur bei Einzelfragen ausreichende Expertise aufbringen, um Reformvorschläge zu formulieren.
Bei der Auseinandersetzung innerhalb der Kernexekutive ist daher von entscheidender Bedeutung, welche Partei(gruppierung) über die Ressourcen des BMG verfügt. Das von Ulla Schmidt geleitete Ministerium hat beim GKV-WSG wesentliche SPD-Positionen geprägt. Innerhalb der SPD gelang es allerdings der Parlamentarischen Linken, durch die Formulierung radikaler Forderungen den Verhandlungsspielraum des BMG gegenüber dem Koalitionspartner zu begrenzen. Die Parteispitze hatte zunächst nur geringen Einfluss. Erst mit dem Wechsel an der SPD-Spitze von Matthias Platzeck zu Kurt Beck im April 2006 erhöhte sich der Einfluss der SPD-Parteispitze. Verstärkt wurde der Einfluss von Beck durch die führende Rolle des Bundeslandes Rheinland-Pfalz bei der Positionierung der A-Länder (SPD-geführte Länder) seit dem Machtverlust in Nordrhein-Westfalen.
Auf Unionsseite stellten die formale Gegenposition zum BMG und zum SPD-Parteivorsitzenden das Bundeskanzleramt und die Bundeskanzlerin dar. Das Bundeskanzleramt konzentrierte sich auf ausgewählte Zielvorgaben, die in die eigentlichen Verhandlungen eingebracht wurden, und auf einige zentrale Punkte, die in den Fachverhandlungen nicht gelöst werden konnten. Bei der Gesetzesformulierung übte das Kanzleramt nur einen geringen steuernden Einfluss auf die CDU/CSU-Fraktion aus (Interview 16). Das Bundeskanzleramt verfügt auf der Fachebene nur über eingeschränkte gesundheitspolitische Expertise und kann daher die Richtlinienkompetenz gegenüber dem BMG kaum umsetzen. Die Rolle der Fachabteilungen im Bundeskanzleramt ist zudem unzureichend definiert (Sturm und Pehle 2007).
Die Führung der CDU/CSU-Fraktion war bei der Formulierung des GKV-WSG vergleichsweise stark in die Verhandlungen auf Sachebene eingebunden, da hier aufgrund von Erfahrungen mit früheren Reformen besonderer Sachverstand verfügbar war. Die Parteispitze der CSU wiederum hat bis Ende 2006 versucht, wesentlichen Einfluss auszuüben (Interview 7). Parteispitze und Exekutive lassen sich im Fall der Regierung des Bundeslandes Bayern nicht voneinander trennen.
Mit dem Eintritt in die Bundesregierung erweitern sich die Ressourcen einer Partei um ein Vielfaches. Durch die Übernahme von Ministerien respektive des Kanzleramts erlangen die Parteien Zugang zu einem administrativen Unterbau. In der Konsequenz agierte die CDU im Reformprozess vor allem über die neu gewonnene institutionelle Basis in der Bundesregierung, das Bundeskanzleramt (BK). Neben Kanzlerin Angela Merkel, die den Prozess intern immer begleitete, waren auf Seiten des BK Staatsministerin Hildegard Müller und der Chef des Planungsstabes, Matthias Graf Kielmansegg, intensiv beteiligt (Interview 10; Interview 16).
Als Müller wegen der Geburt ihres Kindes ihr Amt ruhen ließ, wirkte Thomas de Maizière ebenfalls sehr konstruktiv an der Reform mit (Interview 5; Interview 16). Vor allem zeichnete sich das Kanzleramt unter de Maizière durch eine neue Standfestigkeit gegenüber Lobbyinterventionen aus (Interview 10; Interview 11; Knieps 2007: 876).
In Person des Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder war die CDU/CSU-Fraktion intensiv in den Reformprozess eingebunden (Interview 14; Interview 19). Mit der ihm unterstellten Planungsabteilung besaß Kauder ebenfalls Zugang zu spezifischen Ressourcen. Auf Fachebene wurde die Union vom Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Zöller repräsentiert, dem mit dem ehemaligen Büroleiter von Horst Seehofer, Manfred Lang, ein erfahrener Fachmann zur Seite stand (Interview 10; Interview 14). Lang gilt bei Vertretern beider Verhandlungsparteien als der qualifizierteste Experte auf der Seite der CDU/CSU (Interview 11). Zudem hatte er bereits für die Union mit der rot-grünen Regierung über das Gesundheitsmodernisierungsgesetz verhandelt (Interview 10; Interview 11).
Zöller fiel durch seine fachliche Expertise und die Unterstützung der CSU in den Eckpunkteverhandlungen die Verhandlungsführung auf Unionsseite zu (Interview 8). Die Fraktionsführung übte in den Verhandlungen einen kontinuierlichen Einfluss aus und dominierte in der Phase der Gesetzesformulierung auf Unionsseite (Interview 19). Die CSU-Landesgruppe wurde regelmäßig konsultiert, da diese in der Unionsfraktion faktisch eine Vetoposition besitzt (Interview 14). Hingegen war die Fraktionsarbeitsgruppe Gesundheit an der Ausarbeitung nur wenig beteiligt (Interview 10; Interview 14; Interview 17).
Die B-Länder (unionsgeführte Länder) spielten im Arbeitsprozess eine wichtige Rolle, da mehrere Sozialminister aktiv eingebunden waren. Vor allem der saarländische Sozialminister Josef Hecken stützte den Verhandlungsführer Zöller (Interview 10; Interview 16). Durch die Anwesenheit von Hecken, der als ehemaliger Staatssekretär mit der Denkweise eines Ministeriums vertraut war, erhöhte sich die Kompromissfähigkeit in den Verhandlungen (Interview 11). Allerdings zeigt die Akteurskonstellation, dass die Große Koalition aus drei Parteien besteht, deren Positionen für einen Kompromiss integriert werden müssen (Interview 7). Neben den Akteuren der CDU spielte vor allem die CSU als dritte Regierungspartei eine bedeutende Rolle (Interview 3; Interview 7).
Auf Seiten der SPD ergab sich ein ähnliches Bild wie bei der Union. Wiederum überwog der exekutive Arm mit dem BMG, das als federführendes Ressort die SPD-Positionen koordinierte. Trotz überschneidender Ressortzuständigkeiten hatte das BMG im interministeriellen Aushandlungsprozess die Gestaltungsmacht. Die beiden neben dem BMG für Gesundheitsreformen zentralen Ressorts – das Bundesministerium der Justiz (BMJ) und das Bundesministerium der Finanzen (BMF) – waren SPD-geführt und hielten sich aufgrund geringen Interesses (BMJ) oder fehlender fachlicher Expertise (BMF) weitgehend aus dem Prozess heraus (Interview 1; Interview 19). Lediglich bei der Steuerfinanzierung der Gesundheitskosten war das BMF involviert, wobei Finanzminister Peer Steinbrück die Position des BMG unterstützte (Interview 1). Im BMG war vor allem der zuständige Abteilungsleiter Franz Knieps der intellektuelle Kopf wesentlicher Reformteile (Interview 4; Interview 10; Interview 12; Interview 14; Interview 18).
Das BMG besitzt mit dem ausgebauten Führungsstab quasi ein »kleines Kanzleramt« (Interview 8). An der strategischen Planung waren auf Leitungsebene, neben der Ministerin und Knieps, der Leiter der Abteilung »Leitung und Kommunikation«, Ulrich Tilly, und teilweise der Leiter der Unterabteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Klaus Vater, intensiv beteiligt (Interview 12; Interview 18). Die besondere Rolle von Knieps – idealtypisch für »Kompetenz« hauptverantwortlich, Tilly – idealtypisch für »Durchsetzung« hauptverantwortlich – und Vater – idealtypisch für »Kommunikation« hauptverantwortlich – bestätigt, dass auch seitens des BMG die drei strategischen Dimensionen des SPR als kritisch für ein erfolgreiches Politikmanagement angesehen werden.
Während Ministerin Schmidt die Hauptlinie für die SPD in den Verhandlungen vorgab, waren die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Elke Ferner, und die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, Carola Reimann, für die Rückbindung in die Fraktion verantwortlich. Elke Ferner kam eine herausgehobene Bedeutung unter den Abgeordneten zu, da sie durch eine Entscheidung der Fraktion legitimiert war (Interview 5). Sie sollte die divergierenden Strömungen in der SPD, insbesondere die Parlamentarische Linke, integrieren (Interview 7), wenngleich Ferner damals keine Expertin für Gesundheitspolitik war (Interview 10; Interview 11).
Der Fraktionsvorsitzende Peter Struck war an den politischen Spitzenrunden immer beteiligt (Interview 10; Interview 11). Insgesamt überwog dennoch der Einfluss des Ministeriums gegenüber der Fraktionsführung (Interview 11). Die Abgeordneten der Fraktionsarbeitsgruppen besaßen keinen inhaltlichen Einfluss auf die grundsätzliche Struktur des Gesetzes (Interview 11).
Die A-Länder wirkten über die Sozialministerin des Landes Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, innerhalb der SPD als Vermittler. Dreyer bildete mit Ministerin Schmidt und Ferner ein Verhandlungstrio. Sie hielt den Kontakt zum rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Beck, koordinierte die A-Länder und war insgesamt ein sehr starker Player (Interview 7; Interview 10). Auch nach seinem Wechsel an die Parteispitze blieb für Beck der Regierungsapparat der rheinland-pfälzischen Landesregierung eine wichtige Ressource (Interview 7), wodurch die Bedeutung von Dreyer für die Verhandlungen weiter anstieg.
Mit dem Wechsel an der SPD-Spitze von Platzeck zu Beck trat vor allem der neue Parteivorsitzende in den Vordergrund. Platzeck hatte sich wenig interessiert an der Gesundheitspolitik gezeigt (Interview 5; Interview 7; Interview 10; Interview 13) und Ministerin Schmidt alle Freiheiten gelassen (Interview 7). Beck zog dagegen die konflikthaften Themen um die Überforderungsklausel und den Risikostrukturausgleich zwischen den Krankenkassen stark an sich (Interview 7; Interview 10; Interview 13).
Indem Beck die Kompromisse mit der Union intern vertrat und Kritik aus der Partei gegenüber dem Koalitionspartner kommunizierte, nahm er auf Seiten der SPD die entscheidende Vermittlerrolle gegenüber den Koalitionspartnern ein (Interview 7). Beim Parteivorstand der SPD existierte eine Begleitgruppe zum GKV-WSG unter starker Beteiligung der Parlamentarischen Linken. Die Parteizentrale war ähnlich wie bei der CDU nur wenig in den Prozess involviert (Interview 3; Interview 7).
Letztendlich waren die Entscheider (auf der politischen Ebene) für die Parteien auf Unionsseite Kanzleramtsminister de Maizière, Staatsministerin Müller und Kanzlerin Merkel (Interview 3; Interview 5), während auf SPD-Seite Ministerin Schmidt, Vizekanzler Franz Müntefering und später der Parteivorsitzende Beck bestimmend waren (Interview 3; Interview 12).
Konkrete Interessenkonstellation und Verhandlungsebenen Eine erste Erklärung für die unterschiedlichen Politikergebnisse bei der Struktur- und Finanzierungsreform findet sich bei einer Analyse der jeweiligen Interessenkonstellationen. Die Strukturreform wurde im Wesentlichen auf der Arbeitsebene verhandelt, auf der die Fachministerien dominieren. Hier stehen in der Krankenversicherungspolitik üblicherweise dem BMG ein bis zwei führende Landesministerien des anderen parteipolitischen Blocks gegenüber, beim GKVWSG vor allem der Länder Baden-Württemberg und Bayern. Verstärkt werden die jeweiligen Verhandlungsgremien durch einzelne Experten aus den Fraktionen oder dem Kanzleramt, seltener aus den Parteien.
Die Komplexität der Materie mindert die Bedeutung formaler, institutioneller Macht für das Politikergebnis und überlässt Akteuren mit besonderer fachlicher Kompetenz einen größeren Gestaltungsspielraum. Entsprechend dominierte hier das BMG. Lediglich in der letzten Phase der Aushandlung haben die Fraktionsführungen an Bedeutung gewonnen. Abbildung 1 verdeutlicht diese Konstellation. Die jeweilige Größe der einzelnen Ovale stellt den unterschiedlichen Einfluss der Akteure im konkreten Prozess dar.
Die Finanzierungsproblematik war dagegen eine politisch brisante Frage, die von Akteuren aus den Parteispitzen wesentlich stärker geprägt wurde (Abbildung 1 rechts). Auf der parteipolitischen Spitzenebene sind institutionelle Restriktionen des bundesrepublikanischen Regierungssystems von hoher Erklärungsrelevanz (Lehmbruch 1998). Führende Akteure werden nicht nur von ihren individuellen Interessen geleitet, sondern folgen oft übergeordneten Logiken wie ideologischen Grundsätzen oder den spezifischen Handlungsrationalitäten ihrer Organisation. Zudem bewegen sich die Akteure in einem spezifischen Institutionensetting, welches bestimmte Handlungen restringiert, aber auch Handlungsoptionen bereitstellt (Scharpf 2000).
Die Ausgangslage für beide Arenen war nahezu diametral unterschiedlich. Dies wird deutlich an den zentralen Zielen der Akteure sichtbar. Vereinfacht lassen sich die Ziele Finanzierbarkeit, Qualität, Solidarität und Wachstum unterscheiden. Einzeln und auch jeweils in Kombination mit einem anderen Ziel ist jedes dieser Ziele zu verwirklichen. Eine gleichzeitige Verwirklichung der Ziele Wachstum, Finanzierung und Solidarität ist jedoch nicht möglich. Ob es Konflikte zwischen dem Ziel der Qualitätssteigerung und den anderen Zielen gibt, ist umstritten (Bandelow 2006: 159).
Abbildung 2 verdeutlicht, dass aus diesen Zielkonflikten unterschiedliche Probleme für die Arenen entstehen. Auf der Fachebene findet sich eine weitgehende Übereinstimmung der Ziele. Sowohl Fachpolitiker aus der SPD als auch die arbeitnehmernahen Gesundheitsexperten aus der Union verfolgen primär das Ziel der Qualitätssicherung und als Nebenziel die Gewährleistung einer gleichmäßigen Gesundheitsversorgung unabhängig vom Einkommen.
Konflikte entstehen weniger durch die verschiedenen eigenen Ziele der beteiligten Akteure als durch Einflüsse der politischen Spitzenebene. Vor allem auf Unionsseite wird die Orientierung der Fachebene nicht von der Parteispitze geteilt. Dennoch ist unmittelbar erkennbar, dass ein problemlösungsorientierter Diskurs zwischen den Fachpolitikern vergleichsweise wahrscheinlich ist.
Auf der parteipolitischen Spitzenebene müssen dagegen Kompromisse zwischen den drei konkurrierenden Zielen Finanzierung, Wachstum und Solidarität gefunden werden. Obwohl die Spitzen beider Parteien dem Ziel der Finanzierbarkeit oberste Priorität einräumen, ist es schwierig, eine gemeinsame Lösung zu finden. Dies liegt unter anderem an dem politischen Druck durch die Parlamentarische Linke auf SPD-Seite und durch Unionspolitiker mit engem Kontakt zu Leistungsanbietern (vor allem Kassenärzte, Private Krankenversicherung (PKV), und Pharmaindustrie) auf der anderen Seite. Hinzu kommt das Problem des überlagernden Parteienwettbewerbs: Angesichts der Konkurrenz um Wählerstimmen ist eine Problemlösungsorientierung auf der politischen Spitzenebene erschwert.
3.2 Innovationskultur fördern: asymmetrische Experteneinbindung
Auf den ersten Blick ist das Gesundheitswesen durch eine ausgeprägte Innovationskultur gekennzeichnet. Die eng verschachtelten Verhandlungsgremien bilden ein positives Umfeld für die systematische Ausschöpfung interner Expertise. Durch die Einberufung von Kommissionen unter Beteiligung von Wissenschaftlern im Vorfeld der Reformen wurden auch externe Experten eingebunden. Zusätzlich kann die Politik auf ständige wissenschaftliche Beratungsgremien zurückgreifen, zu denen unter anderem der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und der Wissenschaftliche Beirat des Bundesversicherungsamtes gehören.
Tatsächlich war die Expertenebene im Aushandlungsprozess bei der Finanzierungsfrage jedoch weitgehend von der politischen Ebene entkoppelt. Die eigentliche Entscheidung für den Gesundheitsfonds und dessen Ausgestaltung wurde als politischer Kompromiss unabhängig von den weitgehend kritischen Einschätzungen der externen und internen Sachverständigen getroffen. Ein Problem bestand darin, dass auf der parteipolitischen Spitzenebene wenig gesundheitspolitische Fachkompetenz eingebunden wurde. Insbesondere auf Unionsseite war der zentrale Experte mit Verpflichtungsfähigkeit – Horst Seehofer – nicht an der Aushandlung der Finanzierungsreform beteiligt.
Auf der anderen Seite erfüllt die Aushandlung der Strukturreform weitgehend die Anforderungen des SPR an Innovationskultur. So wurde etwa bei der Zusammensetzung auf personelle Kompetenzen und Leadership geachtet. Führende BMG-Experten stammen aus der Selbstverwaltung und haben hier Erfahrungen sowohl fachlicher Art als auch in Bezug auf die Strategien der Interessenverbände erworben.
Bei der Information über internationale Trends findet eine systematische Einbindung externer Expertise statt. Die intensive wissenschaftliche Befassung mit gesundheitspolitischen Fragestellungen führt zur Bereitstellung eines umfangreichen Steuerungswissens (Gerlinger 2002: 137). Kenntnisse über internationale Reformvorbilder werden zudem von mehreren politikberatenden Institutionen zur Verfügung gestellt – insbesondere durch das Europäische Observatorium für Gesundheitssysteme und Gesundheitspolitik und durch den »Health Policy Monitor« der Bertelsmann Stiftung – und vom BMG auch nachgefragt (vgl. Schlette, Knieps und Amelung 2005).
Insgesamt ist der Kenntnisstand im BMG als hoch einzuschätzen. Insbesondere der Wissensbestand über Steuerungseffekte im Bereich finanzieller Steuerungsanreize ist »recht ausgeprägt« (Gerlinger 2002: 137). Durch diverse Beratungsgremien existieren stabile Kommunikationskanäle zwischen Wissenschaft und Regierung, wodurch ein kontinuierlicher Informationsfluss gesichert wird.
In der Gesundheitspolitik erweist sich vor allem interne Expertise in Form von Erfahrungswissen als zentrale Ressource. Durch den lang andauernden Wandlungsprozess sind Akteure im Vorteil, die bereits frühzeitig am Prozess beteiligt waren und die die internen Diskussionen verfolgen konnten. Zur Entwicklung des GKV-WSG wurde seitens des BMG ein Rückgriff auf externe Expertise nur selten für nötig befunden, da aus vorhergehenden Reformprozessen und durch die Vernetzung mit den politikfeldspezifischen Akteuren ein ausreichender Wissensbestand vorlag (Interview 1; Interview 11; Interview 12).
Die Überlegenheit des BMG gegenüber den anderen kollektiven Akteuren der Kernexekutive basiert vor allem auf der Existenz eines institutionellen Gedächtnisses. Durch die gesammelten Erfahrungen aus den Reformprozessen seit Ende der 80er Jahre existiert ein reichhaltiger Wissensbestand, der neben einer umfassenden Kenntnis der Policy-Instrumente insbesondere ein ausgeprägtes Politics-Wissen über Entscheidungsprozesse der Selbstverwaltung sowie die Positionen und Verhaltensweisen der politikfeldspezifischen Verbände umfasst. Im Gegensatz zum Ministerium hat die Unionsseite zur Ausarbeitung von Kompromissmodellen gezielt Wissenschaftler und Verbandsexperten eingebunden (Interview 14). Der übergreifende Konsultationsprozess mit der Wissenschaft zu Finanzierungsfragen wurde jedoch 2005 beendet (Interview 16). Im Fokus späterer Konsultationen stand allein die Bewertung einzelner Kompromissoptionen.
Die Bedeutung externer Expertise wird vom gesundheitspolitischen Entscheiderkreis ambivalent bewertet. Externe Expertise dient in dieser Perspektive hauptsächlich dazu, eine Debatte zuzuspitzen, die eigenen Vorschläge zu legitimieren und Informationen einzuholen (Interview 1; Interview 11). In der Folge wird externe Expertise als »gesteuert« wahrgenommen (Interview 1; Interview 10; Interview 11). Experten haben sich dadurch desavouiert, dass sie offensichtlich Verbandspositionen vertraten (Interview 11) und nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen kommunizierten (Interview 1). Ein Einfluss von Experten besteht nur, wenn die Information nicht öffentlich erfolgt und die Verschwiegenheit gewahrt wird (Interview 1).
Der Ausbau von personellen Kompetenzen und Leadership erfolgte lediglich auf Seiten der Sozialdemokraten. Ministerin Schmidt war hier die Person mit der größten fachlichen und politischen Kompetenz (Interview 12), weshalb ihre Führungsrolle allgemein akzeptiert wurde (Interview 11; Interview 12; Interview 15). Auf Seiten der Union bestand zwar fachliche Kompetenz auf Mitarbeiterebene. Die Führungsrolle wechselte jedoch in Abhängigkeit von Entscheidungsphase und Gegenstand, sodass keine fachlich und politisch unumstrittene Verhandlungsführung bestand.
3.3 Kommunikationskapazitäten stärken: historische und taktische Hindernisse
Im Gegensatz zur fachlichen Kompetenz und zur prozessualen Durchsetzung lassen sich bei der Kommunikation des GKV-WSG die beiden zentralen Ebenen nur schwer trennen. Ohne kommunikative Geschlossenheit zentraler Akteure fehlt es der Kernexekutive an ausreichenden Kommunikationskapazitäten. Voraussetzung hierfür ist eine homogene Akteurskonstellation mit gleichlautenden Interessen (Interview 13). Dem Politikfeld Gesundheit mangelt es bereits an diesen fundamentalen Voraussetzungen.
Eine zersplitterte Akteurslandschaft mit starken, mobilisierungsfähigen Verbänden trifft auf massive Verteilungskonflikte zwischen und innerhalb der Akteursgruppen. Bundesländer und die Verbände von Kapital und Arbeit sind intensiv eingebunden, jedoch durch stark divergierende Interessen getrennt. Die direkte Betroffenheit aller Wähler führt zu hoher öffentlicher Aufmerksamkeit und zu einem besonderen Skandalisierungspotenzial. Gleichzeitig fehlt es jedoch an systematischen Rückkoppelungen der Bürgerperspektive an die Entscheidungsebene. Somit sind die Bedingungen für eine zielgenaue und konsistente Reformkommunikation denkbar ungünstig.
Eine Abstimmung der Kommunikation im Sinne einer Zentralisierung und Steuerung ist schon deshalb nur sehr eingeschränkt realisierbar, weil die individuellen Akteure untereinander im Wettbewerb stehen und die Kommunikation für ihre individuelle Positionierung nutzen (Interview 12; Interview 13; Interview 16). Partei und Fraktion haben nur eingeschränkte Sanktionsmöglichkeiten (Interview 13; Interview 16; Interview 17). Generell gilt: Kommunikation findet immer unter den Wettbewerbsbedingungen des politischen Systems statt, wodurch selbst eine abgestimmte Kommunikation zwischen Fraktion, Parteizentrale und Ministerium einer Partei stark verkompliziert wird (Interview 13).
Erschwerend wirken Veränderungen im journalistischen Umfeld. In der Vergangenheit existierte im Politikfeld Gesundheit ein innerer Kreis von Journalisten mit exklusivem Informationszugang, dessen Aufbau auch Strategie des BMG war (Interview 11). Der Journalistenkreis hat sich ausdifferenziert. Unter dem Eindruck größerer Konkurrenz fokussieren die Journalisten nach Einschätzung der Entscheidungsträger nur wenige Punkte, beschäftigen sich nicht mehr intensiv mit der komplexen Thematik und lancieren falsche Informationen (Interview 10; Interview 11; Interview 12).
In der Folge werden politische Entscheidungen als handwerkliche Fehler dargestellt und auf diese Weise wird ein falsches Bild von Gesetzen in der Öffentlichkeit gezeichnet (Interview 11). Die Presse greift nur Konflikte auf, konsensuale Punkte nimmt sie dagegen kaum wahr (Interview 1; Interview 12; Interview 16). Viele Vorschläge sind zudem »politisch unsexy« und werden daher trotz ihrer Bedeutung nicht kommuniziert (Interview 12).
Für die Wahrnehmung der Gesundheitsreform in der politischen Öffentlichkeit war die verfehlte Kommunikation der Koalition von entscheidender Bedeutung. Regierung, Fraktionen und Parteien folgten unterschiedlichen Interessen, was institutionelle Anpassungen – wie etwa eine übergreifende Institutionalisierung der Reformkommunikation – erschwerte. Eine starke, verpflichtungsfähige Verhandlungsführung könnte die einzelnen individuellen Akteure mittelfristig auf eine Kommunikationsstrategie verpflichten, die öffentlichen Stellungnahmen der Akteure koordinieren und Fehlverhalten sanktionieren. Beim GKV-WSG war der Kreis der beteiligten Akteure hierfür zu groß, die Verpflichtungsfähigkeit der Führungspersonen auf Unionsseite zu gering und der politische Wettbewerb zwischen den Koalitionsparteien zu ausgeprägt.
Bei der aktuellen Gesundheitsreform war die Kommunikation für die Regierung nur zweitrangig, im Fokus stand die Kompromissfindung in der Koalition (Interview 18). Es erfolgte keine Abstimmung der Kommunikation mit den Verhandlungspartnern, eine über die Tagesaktualität hinausgehende Öffentlichkeitsarbeit der Regierung wurde erst nach dem Kabinettsbeschluss etabliert.
Die kommunikativen Probleme der fehlenden Strategie bei der Finanzreform zeigten sich bereits in der Arbeitsgruppenphase. Über die starke öffentliche Begleitung der Arbeitsgruppe wurde ein hoher Druck auf die handelnden Akteure aufgebaut, sich parteitaktisch und opportunistisch zu verhalten (Interview 3). Ab Mai 2006 waren die Verhandlungen in der Arbeitsgruppe durch einen heftigen und andauernden Streit gekennzeichnet (Interview 10). Es kam zu einer starken Polarisierung in der Arbeitsgruppe. Vermeintliche Zwischenstände wurden durch Einzelakteure nach außen getragen. Die Medien griffen angesichts fehlender tatsächlicher Verhandlungsergebnisse jede Stellungnahme auf (Knieps 2007: 876f.).
Die Verhandlungspartner drifteten in der Kommunikation auseinander, wobei insbesondere die Vertreter parteiinterner Extrempositionen die Verhandlungen gezielt zur eigenen Profilierung nutzten (Interview 5; Interview 11; Interview 12) und so einen stark negativen Einfluss auf die öffentliche Reformwahrnehmung ausübten (Interview 11). Es fügt sich ins allgemeine Bild, dass die öffentliche Lancierung des Gesundheitsfonds durch Volker Kauder im April 2006 ebenso wenig abgesprochen war (Interview 11; Interview 15).
Bei der Beurteilung der mangelhaften Kommunikationskapazitäten ist die Reformgeschichte der Vorgängerreformen zu beachten. Für die beteiligten Akteure aus der Kernexekutive war die Erfahrung prägend, dass ein kommunikativer Erfolg nicht möglich ist (Interview 1; Interview 11). So wurden bei anderen Reformen unterschiedliche Kommunikationsstrategien verfolgt, die jedoch nie zu einer positiven Resonanz geführt haben. Die Stärkung der Kommunikationskapazitäten wurde nicht angestrebt.
3.4 Strategisches Machtzentrum etablieren: bipolare Zentrenbildung
Für die Durchsetzung politischer Reformen ist ein strategisches Machtzentrum von großer Bedeutung. Auch diese Forderung ist in den beiden Arenen in unterschiedlichem Maß erfüllt. Auf der parteipolitischen Spitzenebene konnte kein stabiles Machtzentrum etabliert werden. Das Bundeskanzleramt besaß aufgrund unterschiedlicher parteipolitischer Prägungen keinen direkten Einfluss auf die Handlung des Gesundheitsministeriums (Interview 8; Interview 11).
Die Existenz zweier gleich starker Parteien bedingt eine Splittung des strategischen Machtzentrums (Interview 14). Mit den Führungsstäben von Bundeskanzleramt und BMG existierten durchweg zwei strategische Machtzentren, die aufgrund kongruenter Interessen situativ miteinander kooperierten. Wiederum wird die hohe Bedeutung der Ressource Vertrauen für politische Prozesse offensichtlich, deren Vorhandensein zwischen Kanzlerin Merkel und Ministerin Schmidt eine Kooperation zwischen den Zentren trotz unterschiedlicher parteipolitischer Färbungen ermöglichte. Ein Konfliktfrühwarnsystem konnte daher zwar in speziellen Situationen funktionieren, war jedoch nicht systematisch institutionalisiert.
Die interne Abstimmung war auf der parteipolitischen Spitzenebene vor allem in der Union schwierig, da es in verschiedenen Phasen unterschiedliche Einflüsse von Ministerpräsidenten gab (Interview 7; Interview 8; Interview 10; Interview 11; Interview 12; Interview 15). Das Fehlen eines Konfliktfrühwarnsystems wird unter anderem daran deutlich, dass der Bundesrat trotz vorheriger Einbindung der Länder in die Formulierung des Gesetzentwurfes insgesamt 104 Änderungsanträge gegenüber dem ausgehandelten Kompromiss eingebracht hat (Bundesrat 2006).
Auf der Fachebene bestand ein spezielles Problem auf der Unionsseite, da mit dem Politikfeldwechsel von Horst Seehofer kein intern dominanter Verhandlungsführer mit ausgewiesenen Fachkenntnissen beteiligt war. Wolfgang Zöller war im Vergleich zu Seehofer nicht ausreichend anerkannt und fachlich wie rhetorisch geschult, um sich in Partei und Fraktion gegen Widerstände durchsetzen zu können (Interview 5; Interview 10). Es ist ihm daher nicht immer gelungen, für Verhandlungsergebnisse mit der SPD auch interne Unterstützung zu sichern (Interview 7; Interview 10; Interview 19).
Während die Verhandlungsgruppe der Union schlecht koordiniert war, zeichnete sich die SPD-Seite durch eine gute Rollenverteilung und eine ressortübergreifende Vernetzung aus (Interview 10). Im Vorfeld der Führungsgremientreffen sicherte die Bundesgesundheitsministerin ihre Position immer in Vier-Augen-Gesprächen mit dem Parteivorsitzenden ab (Interview 7; Interview 11). Vor jeder Verhandlungsrunde wurden SPD-intern Vorgespräche mit Vertretern von Ministerium, Parteilinken und Bundesländern geführt (Interview 5). Die Fraktion spielte dabei zumindest immer eine formale Rolle. Bei jedem neuen Schritt wurden zudem Konsultationen mit der Fraktionsarbeitsgruppe durchgeführt. Schmidt besaß einen großen Verhandlungsspielraum und sah sich auf Unionsseite keiner Person gegenüber, die ein verlässliches Gegenangebot unterbreiten konnte (Interview 10; Interview 12; Interview 19).
3.5 Erfolgskontrolle in der Kernexekutive: Politics- statt Policy-Orientierung
Die Voraussetzungen für die Sicherung der Erfolgskontrolle waren in der Gesundheitspolitik weitgehend ungünstig. Die Anwendung von Evaluationstechniken steht vor dem Problem konkurrierender Ziele mit unterschiedlichen Parametern. Diese Ziele sind auch nicht immer quantifizierbar. So ist etwa die Operationalisierung der Qualität eines Gesundheitswesens umstritten. Ein weiteres Problem besteht in der Verantwortung von Gremien der Selbstverwaltung für die Umsetzung von Teilen der Reform. Eine prozessbegleitende Bewertung mit der Sicherstellung von Lernprozessen scheitert unter anderem an wechselnden Akteuren in unterschiedlichen Politikphasen.
Bisher verfügt das BMG noch nicht über eine Tradition prozessbegleitender Evaluation (Interview 1). Die speziellen Akteurskonstellationen, Umsetzungsprobleme und Politikauswirkungen werden nicht systematisch zu den Entscheidern bei der Politikformulierung rückgekoppelt.
Auch die Analyse der öffentlichen Resonanz erfolgt bisher nicht systematisch. Vor allem die Pflege des Dialogs mit den Stakeholdern, also den Leistungsanbietern und den Finanzierungsträgern, wird als schwierig angesehen. Was den Einfluss der Verbände angeht, hat das BMG eine gezielte Strategie der Abschottung etabliert. Bei früheren Reformen hatten insbesondere die Verbände der Krankenkassen noch Gesetzesteile vorformuliert (Interview 11), seit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz hat das BMG die Verbände aus dem Prozess herausgehalten.
Seitens der Verbände wurden daraufhin gezielt – wie auch schon unter der rot-grünen Regierung – das Kanzleramt und die Fraktionsführungen adressiert. Allerdings fehlte im BK ein Akteur mit direkten Verbandsbeziehungen. Kanzleramtsminister de Maizière hat die Interventionen der Verbandsfunktionäre gezielt abgewiesen (Interview 11). Bei beiden Koalitionsparteien hat sich über die diversen Reformen seit dem Gesundheitsstrukturgesetz der Eindruck verfestigt, dass die Verbände allein destruktiv agieren und Reformen ungeachtet der tatsächlichen Inhalte fundamental ablehnen. Verbandskontakte haben deshalb massiv an Bedeutung verloren. Die Fachpolitiker lassen sich verstärkt durch ihre ideellen Ziele und weniger durch intensive Verbandskontakte leiten.
Möglichkeiten zum flexiblen Nachsteuern, also etwa zur nachträglichen Modifikation von Beschlüssen, wurden gezielt ausgeschlossen. Sowohl bei der Einführung des Gesundheitsfonds als auch bei der Strukturreform bemühten sich die Entscheider um möglichst geringe Umsetzungsspielräume. Damit reagierte man auf die vorangegangenen Erfahrungen eines unerwünschten Einflusses von Regelungsadressaten in der Politikumsetzungsphase. Die Erfolgskontrolle konzentrierte sich aufgrund der bisherigen Erfahrungen in der Gesundheitspolitik auf Politics-Fragen, während Policy-Aspekte bewusst ausgeblendet wurden.
In Bezug auf die Durchsetzung von Reformen wurde systematisch politisches Lernen auf der Fachebene praktiziert. Dies betrifft vor allem die personelle Zusammensetzung des Entscheidungsnetzes. Die Erfahrungen der Vorgängerreformen wurden genutzt, indem ein möglichst kleiner Kreis von Fachpolitikern mit der Aushandlung der Strukturreform befasst wurde. Ziel war es unter anderem, den Einfluss von Stakeholdern über Verbindungen einzelner Politiker zu reduzieren. Außerdem hat die Erfahrung gezeigt, dass wenige Experten besser in der Lage sind, gemeinsame Sichtweisen für problemadäquate Lösungen zu erarbeiten. Selbst während der Aushandlung des GKV-WSG wurde der Kreis der Beteiligten systematisch reduziert (Interview 2).
Lernen sollte somit vor allem in Bezug auf politische Strategien gesehen werden (»einfaches Lernen«, Bandelow 2003b). Komplexe Lernprozesse sind dagegen in der Kernexekutive bisher nicht gewünscht. Insgesamt erfüllte die Kernexekutive nur in der Arena der Strukturreform einen wesentlichen Teil der Kriterien des SPR. Bei der Finanzierungsreform dominierte dagegen die politische Logik, sodass die Voraussetzungen für eine systematische Berücksichtigung von Kompetenz und Kommunikation nicht gegeben waren.
4 Agenda-Setting: verschiedene Lösungen für bereits bekannte Probleme
Die Aushandlung des GKV-WSG begann schon vor der Bundestagswahl im September 2005. Angesichts des beschriebenen iterativen Reformzyklus und der mehrdimensionalen Reformproblematik von Finanzierungs- und Strukturfragen ließe sich die eigentliche Problemdefinition sogar bis Mitte der 70er Jahre (für die Finanzierungsfrage) bzw. Ende der 80er Jahre (für die Strukturreform) zurückdatieren. Die folgende Analyse beschränkt sich auf die Vorbereitung der tatsächlichen Reforminhalte. Wie die späteren Reformphasen zeichnet sich auch das Agenda-Setting durch parallele Verhandlungen in verschiedenen Arenen aus (Abbildung 3).
Auffällig ist, dass beim Agenda-Setting die Strukturreform zunächst keine Rolle spielte. Beginn dieser Phase war Ende November 2002 mit der Einberufung der »Kommission für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme« (Rürup-Kommission). In der Rürup-Kommission wurden die Modelle zur Reform der Gesundheitsfinanzierung thematisiert, die den gesamten Reformdiskurs prägen sollten.
Analog zum nachfolgenden Prozess erfolgte in der Kommission eine Lagerbildung zwischen den Vertretern des wissenschaftlichen Mainstreams und der Arbeitgeberseite (pro Prämienmodell) sowie den Vertretern der Gewerkschaften und der linken SPD-Linie (pro Bürgerversicherung). Ein Vorstoß zur Formulierung eines Kompromissmodells wurde kommissionsintern verworfen. Parallel hat die Herzog-Kommission der CDU ein eigenes Prämienmodell entwickelt, die »Kopfpauschale« (CDU 2003b).
Während die oft gleichlautenden Kommissionsberichte im Politikfeld Rente schließlich eine weitreichende Rentenreform ermöglichten, wies der Dissens in der Gesundheitspolitik bereits auf die politische Brisanz in diesem Politikfeld hin. Im Jahr 2004 reagierte die SPD auf das CDU-Modell der »Kopfpauschale« mit einer eigenen Kommission beim Parteivorstand unter Leitung von Andrea Nahles, die das SPD-Konzept der Bürgerversicherung politisch ausformulierte (SPD 2004).
4.1 Zukunftsthemen aufgreifen: zwei Problemdefinitionen – zwei Reformkonzepte
Das GKV-WSG greift mit der Frage der zukünftigen Finanzierbarkeit des beitragsfinanzierten Gesundheitssystems angesichts wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und technischer Veränderungen (Erosion des Normalarbeitsverhältnisses, demographischer Wandel, medizinischtechnischer Fortschritt) ein Thema auf, das bereits vor dem eigentlichen Agenda-Setting zu den zentralen Gegenständen der öffentlichen Debatte gehörte. Auch die Problematik der strukturellen Weiterentwicklung des gesundheitspolitischen Mesokorporatismus wurde nicht erst durch das GKV-WSG thematisiert. Der Reformbedarf kann also in beiden Bereichen als seit längerer Zeit bekannt gelten.
Obwohl die Problemlage als solche allgemein anerkannt war, unterscheiden sich die Problemumfeldanalysen und damit auch die Problemdefinitionen besonders im Hinblick auf die Ursachen der Finanzierungsprobleme der GKV. Vor allem auf der parteipolitischen Spitzenebene der Union herrscht die Problemsicht vor, dass steigende Gesundheitskosten die Folge externer Entwicklungen sind. Demographischer Wandel und medizinisch-technischer Fortschritt führen demnach zwingend zu Finanzierungsproblemen im Gesundheitswesen. Massive Interventionen wären folglich zur Kostensenkung unumgänglich.
Auf der anderen Seite werden in der SPD und beim Arbeitnehmerflügel der Union ineffiziente Strukturen in der GKV stärker für die Beitragssatzsteigerungen verantwortlich gemacht. Während also aus der ersten Perspektive ein kollektiv finanziertes gesundheitliches Versorgungsniveau auf dem bisherigen Stand in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, können aus der zweiten Sicht Strukturreformen eine nachhaltige kollektive Finanzierung umfassender Gesundheitsleistungen gewährleisten. Die Problemdefinitionen wirkten sich also stark auf die Vorstellungen über die jeweilige Reformrichtung aus.
Gesundheitspolitischer Reformbedarf wurde von den Akteuren in Abhängigkeit von den jeweils zentralen Zielen wahrgenommen. Beim Agenda-Setting zum GKV-WSG spielte – wie bei allen Reformen seit Mitte der 70er Jahre – vor allem das Problem der Finanzierbarkeit eine zentrale Rolle. Die Reform sollte eine nachhaltige Lösung des Finanzierungsproblems bewirken, ohne dabei andere zentrale Ziele der Union (Wachstum) oder der SPD (Gerechtigkeit) zu verletzen. Vor allem Fachpolitiker gewichteten zudem das Ziel der Qualitätssicherung hoch.
Die Reformkonzepte waren trotz der anfänglichen Beteiligung externen Sachverstands keineswegs fachlich und finanziell abgesichert. So konnte das Modell der Bürgerversicherung unter anderem verfassungsrechtliche Probleme beim Umgang mit dem bestehenden PKV-System nicht klären. Das Modell der Gesundheitsprämie wiederum stand im Widerspruch zum Steuermodell der Union und war im Hinblick auf die Ergänzung durch eine steuerliche Umverteilung finanziell umstritten.
4.2 Reformbereitschaft fördern: Fokus auf Finanzierung
In der politischen Öffentlichkeit bestand in Bezug auf die Gesundheitspolitik nicht nur ein ausgeprägtes Problembewusstsein, sondern auch eine hohe Erwartungshaltung hinsichtlich der Gestaltungsfähigkeit der Großen Koalition. Diese ließ gemeinsam mit der Festlegung im Koalitionsvertrag die faktische Möglichkeit eines Themenwechsels sehr gering erscheinen (Interview 13; Interview 15). Eine sachliche Trennung der Leistungs- von der Finanzierungsseite war unmöglich (Interview 16). Die Planungsakteure haben auf Unionsseite frühzeitig vorgeschlagen, aus der Finanzierungsfrage auszusteigen, und die Fachpolitiker haben immer wieder die Gemeinsamkeiten in anderen Feldern betont, aber die politischen Spitzen hatten den Anspruch des »großen Wurfes«, der mit der Finanzierungsfrage verknüpft war (Interview 14).
Eine Kommunikation aller Leitideen war beim GKV-WSG nur schwer möglich. Denn mediale Aufmerksamkeit konnte nur für das Finanzierungsthema erreicht werden. In der Gesundheitspolitik erweist sich dieser Punkt jedoch als von nachrangiger Bedeutung. Problematisch war auch, dass die Kommunikation durch die Modelldebatte geprägt war. Die Darstellung der beiden vorgeschlagenen Finanzierungsmodelle als unvereinbare Gegensätze erschwerte eine positive Kommunikation möglicher Kompromisse zusätzlich.
Im Konflikt zwischen den Modellen der Bürgerversicherung und der Gesundheitsprämie verpasste es zudem die Union, ihr Modell an den herrschenden Diskurs anzupassen. In der Bevölkerung gibt es eine stabile Unterstützung für die Beibehaltung der Umverteilungsfunktion des Gesundheitswesens (vgl. Bertelsmann Stiftung 2004).
Es bleibt auch fraglich, warum das zentrale und weitgehend konsensuale Qualitätsziel der Reform nicht als Deutungsmuster etabliert wurde. Im Gegensatz zur Problematik der Solidarität besteht hier nicht nur Übereinstimmung zwischen den großen Parteien, sondern auch eine umfassende Mobilisierungsmöglichkeit der Bevölkerung, wie etwa das Beispiel der jüngsten britischen Gesundheitsreformen zeigt (Bandelow 2007b, 2007c). Eine positive Reformkommunikation über das Qualitätsziel wäre grundsätzlich denkbar gewesen, allerdings hätte es für ein Umschwenken in der Kommunikation einer medialen Thematisierung und Skandalisierung von Qualitätsmängeln im Gesundheitssystem bedurft (Interview 13).
4.3 Erfolgsaussichten kalkulieren: Priorität für Profilierung
Auf der parteipolitischen Spitzenebene fehlte eine gezielte Kalkulation der Erfolgsaussichten. Der Reformprozess folgte keinem systematischen Plan der Kernexekutive, sondern war weitgehend das Ergebnis paralleler, unkalkulierbarer Politikprozesse, die jeweils von Machtfragen und dem Wunsch, die eigenen politischen Profilierungschancen zu nutzen, dominiert waren. Daraus resultierten Fehleinschätzungen der tatsächlichen Chancen zur Durchsetzung des jeweils präferierten Finanzierungsmodells:
Auf Seiten der CDU nutzte Angela Merkel bereits 2003 den parteiinternen Streit um das Prämienmodell zu einem Richtungsentscheid. Auf dem Leipziger Parteitag setzte sich Merkel gegen die unionsinternen Kritiker durch und nutzte den Konflikt zur Sicherung ihrer internen Führungsposition (CDU 2003a). Merkel hat sich hierdurch ohne systematische Kalkulation der Erfolgsaussichten an das Konzept der Kopfpauschale gebunden (Interview 10, Interview 14), während die Union mit dem Prämienkritiker Seehofer ihren führenden Fachmann in der Gesundheitspolitik verlor.
Auch in der SPD dominierten Machtkonflikte die Entscheidungsfindung für ein Finanzierungsmodell. Im Wahljahr befand sich die rot-grüne Regierung unter Kanzler Schröder in einem Zustimmungstief. Eine Chance auf den Wahlsieg bestand nur, wenn es der SPD gelang, durch den Reformkurs der Agenda 2010 enttäuschte Stammwähler zurückzugewinnen (Interview 13). Hierzu bedurfte es eines Projektes, das gezielt sozialdemokratische Werte adressierte und die Kernklientel der Sozialdemokraten aktivierte (Interview 7; Interview 13).
Die Bürgerversicherung erwies sich als Projekt mit hohem Symbolwert und Anker für die Identität der SPD (Interview 7). Mit der Anknüpfung an den positiv besetzten Bürger-Begriff und der Adressierung der Solidaritätsfrage besaß das Bürgerversicherungskonzept ein hohes Mobilisierungspotenzial (Interview 7; Interview 13). Allerdings war die Durchsetzung eines SPD-Modells gegen den Widerstand der Union durch die Stimmenverteilung im Bundesrat noch weniger aussichtsreich als ein Erfolg des Prämienmodells.
Das Ergebnis der Bundestagswahl 2005 gab objektiv keinen Anlass, von einem baldigen Gelegenheitsfenster für eine Finanzreform auszugehen. Durch das unerwartet schlechte Wahlergebnis der Union wurden die parteiinternen Rivalen von Angela Merkel wieder gestärkt und die interne Durchsetzungsfähigkeit der Kanzlerin geschwächt (Interview 10). Auch der CSU-Vorsitzende Edmund Stoiber verlor an Durchsetzungsfähigkeit, da er entgegen vorhergehender Ankündigungen nicht in das Kabinett einzog. Die Ausgangskonstellation der Großen Koalition war somit durch die Schwäche führender Unionsakteure gekennzeichnet. Der Koalitionspartner SPD sah sich wiederum dem politischen Druck durch die Linkspartei ausgesetzt (Interview 5; Interview 12; Interview 13).
Beide Volksparteien waren von der Großen Koalition überrascht und in ihren Planungen von einer anderen Konstellation ausgegangen (Interview 1; Interview 5), was sich im hart geführten Wahlkampf widerspiegelte. In den Koalitionsverhandlungen wirkte der starke Parteienwettbewerb nach (Interview 1; Interview 2). Die Debatte um Bürgerversicherung und Kopfpauschale überlagerte die Koalitionsverhandlungen in der Gesundheitspolitik (Interview 2; Interview 7; Interview 15; Interview 17; Interview 19). Zusätzlich konnten inhaltliche Differenzen in der Gesundheitspolitik zwischen den Parteien zur parteipolitischen Profilierung in der Koalition genutzt werden (Interview 3; Interview 13).
Zwischen den handelnden Personen herrschte ein starkes Misstrauen vor, das sich erst mit der Zeit abbaute (Interview 10; Interview 12). CDU und CSU fürchteten von den Experten des BMG dominiert zu werden. Teilweise wurde daher versucht, Mitarbeiter des BMG von der Teilnahme an den Verhandlungen auszuschließen, da diesen ein eigenes politisches Mandat fehle (Interview 5; Interview 14). Zunächst wurden die Themen in Arbeitsgruppen auf der Fachebene vorverhandelt und anschließend in Vier-plus-Zwei-Gesprächen fixiert (Interview 10). Im Themenfeld Gesundheit war auf der Seite der SPD Ministerin Schmidt die Verhandlungsführerin. Auf der Unionsseite hielt Seehofer nochmals das Heft fest in der Hand (Interview 10; Interview 11). Der spätere Verhandlungsführer Zöller war zwar ebenfalls anwesend, trat jedoch hinter Seehofer zurück (Interview 10; Interview 11).
Bei den Verhandlungen beschränkten die Nachwirkungen der Finanzierungsdiskussion die Verhandlungskorridore (Interview 12). Durch die starke Ideologisierung konnte der Finanzierungsstreit nicht konsensual gelöst werden (Interview 1; Interview 11; Interview 19). Das Thema erwies sich als zu komplex und der gegebene Zeitrahmen als zu begrenzt für eine Kompromissfindung in den Koalitionsverhandlungen (Interview 3; Interview 8; Interview 17).
Im Hinblick auf die Finanzierungsfrage wurde im Koalitionsvertrag nochmals die Unvereinbarkeit der Modelle hervorgehoben, jedoch eine Lösung bis Mitte 2006 angekündigt (CDU, CSU und SPD 2005: 102). Für die kommenden Verhandlungen kristallisierte sich ein Veto der Union gegen die Bürgerversicherung heraus, während für die SPD die Gesundheitsprämie nicht verhandelbar war (Interview 3; Interview 8; Interview 13; Interview 15). Essenzielle Bestandteile der Prämie widersprechen den Gerechtigkeitsvorstellungen der SPD (Interview 8; Interview 12; Interview 15; siehe auch SPD 2004; SPD 2005), zudem wurde die Bürgerversicherung symbolisch überhöht (Interview 13). Der politische Verlust, der bei einer Zustimmung zum Modell der Gegenseite drohte, war für eine Verhandlungslösung zu groß (Interview 5; Interview 15).
Die Chancen für eine Lösung in der Finanzierungsfrage wurden in den Koalitionsverhandlungen sogar noch weiter verschlechtert. Trotz der Ablehnung durch die Gesundheitsexperten wurde in den Koalitionsvertrag eine Streichung des Steuerzuschusses an die gesetzliche Krankenversicherung in Höhe von 4,2 Milliarden Euro (2006) aufgenommen (Interview 2; Interview 10; Interview 11; Interview 12).
Erschwerend kam hinzu, dass die vereinbarte Anhebung der Mehrwertsteuer zusätzliche Kosten für die Krankenkassen in Höhe von ca. 900 Millionen Euro erwarten ließ. Hierdurch wurde die Reform jedoch frühzeitig stark belastet und der Verhandlungskorridor weiter eingeengt (Interview 14; Interview 17). In der Entscheidung manifestiert sich, dass die Finanzierungsmodelle nur nach politischen Gesichtspunkten konzipiert, jedoch nicht in ihren Konsequenzen durchdekliniert und fachlich ausformuliert waren (Interview 1; Interview 11; Interview 19; siehe auch Hartmann 2006: 70; Knieps 2007: 871 – 873).
Während für die Finanzreform das Gelegenheitsfenster geschlossen blieb, öffnete sich ein (von den Akteuren zuvor nicht antizipiertes) Fenster für die Strukturreform. In Anbetracht der fehlenden Kompromissoption in der Modellfrage wurde der Fokus im Koalitionsvertrag bewusst auf wettbewerbsfördernde Reformelemente gelenkt (Interview 1). Hier konnten vordergründig bestehende Gemeinsamkeiten genutzt werden, um eine grundlegende Reformlinie zu fixieren.
Zwischen Union und SPD bestanden fünf bis sechs konsensuale Punkte hinsichtlich Wettbewerb, Qualität und Effizienz (Interview 3). Eine Strukturreform konnte zeitnah formuliert werden, da diese beim GMG schon ausverhandelt, damals jedoch an der Blockade von CDU und CSU gescheitert war (Interview 11; Interview 15; siehe auch Seehofer, Storm und Widmann-Mauz 2003; Knieps 2007). Grundsätzlich gab es mit der Maxime des Wettbewerbs einen Konsens über die Eckpfeiler der Reform (Interview 2; Interview 3; Interview 8; CDU, CSU und SPD 2005: 102), obwohl die Wettbewerbskonzepte der Parteien nicht klar umrissen sind (Interview 6; Interview 10).
Die Ausweitung marktförmiger Steuerung stellt seit Längerem auch im Gesundheitswesen eine übergreifende Politiküberzeugung dar, wobei sich der Wettbewerb in einer Ausweitung selektiver Vertragsmodelle und einer Auflösung der monopolistischen Strukturen konkretisiert (Gerlinger 2002: 140ff.). Dennoch differieren die Wettbewerbskonzepte der Parteien jenseits des Konsenses auf der Metaebene in ihrer spezifischen Ausgestaltung stark (Interview 6; Interview 9; Interview 10).
4.4 Erfolgskontrolle beim Agenda-Setting: fehlende Kontrollmechanismen
Das Agenda-Setting folgte keiner politischen Strategie, sondern war das Ergebnis teilweise paralleler Politikprozesse, in deren Mittelpunkt Machtfragen standen. Daher wurden keine inhaltlichen Kontrollmechanismen angestrebt und umgesetzt. Ein Stakeholder-Dialog wurde nur gepflegt, wenn dieser als Ressource in den politischen Auseinandersetzungen dienen konnte. Die frühzeitige Festlegung und Kommunikation einer Unvereinbarkeit der Finanzierungsmodelle versperrten Möglichkeiten des flexiblen Nachsteuerns. Insgesamt verfehlt das Agenda-Setting fast alle Kriterien des SPR für erfolgreiche Reformpolitik-
5 Politikformulierung und Entscheidung: überraschende Ergebnisse
Das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz wurde am 2. Februar 2007 im Bundestag und am 16. Februar 2007 durch den Bundesrat verabschiedet. Im Bundestag stimmten neben der Opposition auch 23 Abgeordnete der Union und 20 Mitglieder der SPD-Fraktion gegen das Gesetz. Im Bundesrat enthielten sich Länderregierungen mit Beteiligung von Oppositionsparteien (Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Berlin) sowie die CDU-SPD-Regierung in Analysedimensionen Sachsen der Stimme. Das Gesetz ist in Teilen zum 1. April 2007 in Kraft getreten. Eine wichtige Ausnahme stellt dabei die Finanzierungsreform dar, da der Gesundheitsfonds erst zum 1. Januar 2009 umgesetzt werden soll.
Mit der Finanzierungsreform und den Maßnahmen zur Strukturreform enthält das Gesetz zwei wesentliche Blöcke. Die Finanzierungsreform sieht die Etablierung einer virtuellen Geldsammelstelle (Gesundheitsfonds) vor (Abbildung 4). Die Einnahmen der einzelnen Kassen sollen zentral verwaltet werden. Für die Ermittlung der prozentualen Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind nicht mehr die einzelnen Kassen zuständig. Die Festlegung erfolgt vielmehr einheitlich durch eine nicht zustimmungspflichtige Rechtsverordnung der Bundesregierung.
Die unterschiedliche Finanzsituation der Kassen wird nicht mehr über den Beitragssatz, sondern über eine Zusatzprämie berücksichtigt. Kassen dürfen Zusatzbeiträge bis zu einem Prozent des Einkommens prozentual oder als Pauschale erheben. Zusatzbeiträge bis acht Euro sind nicht an die Einkommensgrenze gebunden. Hinzu kommt ein Steuerzuschuss, der schrittweise von drei Milliarden Euro (2009) auf 14 Milliarden Euro (2016) angehoben werden soll. Die Kassen erhalten wiederum eine Versichertenpauschale. Dabei wird ein Risikoausgleich berücksichtigt, der anders als der bisherige Risikostrukturausgleich auch besondere Ausgaben für ausgewählte Krankheiten berücksichtigen soll.
Der Gesundheitsfonds beinhaltet somit Elemente aus Forderungen beider Koalitionspartner. Wie von der SPD gefordert, wird der Risikostrukturausgleich ausgeweitet. Auch der einheitliche Kassenbeitrag entspricht sozialdemokratischen Vorstellungen. Außerdem konnte die SPD eine Pflichtversicherung für alle Bürger durchsetzen. Auch die privaten Krankenkassen müssen hierfür ein Angebot mit einem einheitlichen Grundtarif anbieten. Diese Regelung kann als Vorbereitung für eine spätere Erweiterung zu einer Bürgerversicherung gesehen werden.
Die Union wiederum konnte eine nachhaltige Stabilisierung der Arbeitgeberbeiträge sichern. Steigende Gesundheitskosten können über höhere Zusatzbeiträge oder Steuerzuschüsse finanziert werden, ohne dass der Arbeitgeberbeitrag steigen muss. Der wichtigste Erfolg der Union ist jedoch der Zusatzbeitrag, der als kleine Kopfpauschale eine mögliche Grundlage für eine Weiterentwicklung des Fonds zu einer Gesundheitsprämie sein kann.
Der Steuerzuschuss entspricht Forderungen beider Parteien. Er liegt jedoch zunächst noch unter dem früheren Steuerzuschuss von zuletzt 4,2 Milliarden Euro (2006), der durch den Koalitionsvertrag abgeschafft wurde. Seine Höhe ist ebenso wie die Begrenzung des Zusatzbeitrags und der Umfang des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs Ergebnis eines Kompromisses zwischen den Parteien.
Neben der Finanzreform verändert die Gesundheitsreform der Großen Koalition nachhaltig die Entscheidungsstrukturen des Gesundheitswesens. Das GKV-WSG ist ein großer Schritt auf dem Weg vom bisherigen regionalen Mesokorporatismus zu einem integrierten System mit kollektiven Rahmenvorgaben auf der Bundesebene und einzelvertraglicher Organisation der Leistungsmärkte.
So wurden in der ambulanten Versorgung die Grundlagen für Selektivverträge zwischen einzelnen Kassen und Verbänden bzw. Verbünden von Leistungsanbietern erweitert. Die Kassenärztlichen Vereinigungen verlieren damit das Verhandlungsmonopol. Eine Vielzahl von Regulierungen und Begrenzungen in der Vertragsgestaltung zwischen einzelnen Kassen und Leistungsanbietern wurde aufgehoben. Kassenartenübergreifende Fusionen von Krankenkassen wurden ermöglicht. Ein neuer Spitzenverband Bund übernimmt die wichtigsten Funktionen und Kompetenzen der bisherigen sieben Spitzenverbände der Kassenarten. Der Gemeinsame Bundesausschuss, das wichtigste Verhandlungsgremium des Gesundheitswesens, wird professionalisiert und stärker durch das BMG kontrolliert.
Ergänzt werden die Maßnahmen durch eine Honorarreform für Ärzte, die Ausweitung von Möglichkeiten für Rabattverträge zwischen Kassen und Arzneimittelherstellern und die Erweiterung von Kassenleistungen im Bereich von Impfungen und Kuren. Anders als bei vorherigen Gesundheitsreformen wurden weder Leistungen eingeschränkt noch Zuzahlungen erhöht.
Die Politikergebnisse sind das Resultat wechselhafter Verhandlungen auf unterschiedlichen Ebenen. Es ist angesichts der vielfachen Entscheidungswege sowie geschlossener und wieder aufgekündigter Kompromisse wechselnder Verhandlungspartner schwierig, in den Verhandlungen eine konsistente Strategie zu erkennen. Dennoch wurden die Kriterien des SPR für erfolgreiche strategische Reformpolitik auch in dieser besonders problematischen Phase nicht alle missachtet.
5.1 Reformkonzept formulieren: Machtpolitik bei der Finanzierung – Evidenzorientierung bei der Strukturreform
Die Formulierung des Reformkonzepts folgte keiner systematischen Strategie. Der Koalitionsvertrag hatte die Gesundheitsreform zwar auf die Agenda gesetzt, jedoch keine inhaltliche Linie zur Finanzierungsfrage vorgegeben (Interview 3). Nach den Koalitionsverhandlungen sondierten zunächst interne Arbeitsgruppen im BMG und auf Unionsseite Handlungsoptionen und diskutierten mögliche Kompromissmodelle (Interview 13; Interview 18). In dieser Phase wurde auch externer Sachverstand einzelner Wissenschaftler (Richter 2005) oder wissenschaftlicher Beiräte (Bundesministerium der Finanzen 2005) einbezogen (Interview 11; Interview 15; Interview 19).
Die Fachebene stand in den Verhandlungen jedoch unter der Aufsicht der politischen Spitzenebene, die sich eine Konsentierung der Beschlüsse vorbehielt (Interview 13) und von Beginn an in den Prozess eingeschaltet war (Interview 10; Interview 14; Interview 19). Auf Spitzenebene herrschte die Sichtweise vor, die Fachpolitiker hätten bei den vergangenen Reformen keine Erfolge erzielt (Interview 10). Die Gesundheitsreform als zentrales Projekt der Legislaturperiode müsse daher von der Spitze begleitet werden (Interview 14).
Frühzeitig begannen Koordinierungstreffen auf Ebene der Fraktionsvorsitzenden, Staatssekretäre und Minister im Bundeskanzleramt. Ein Spitzengespräch zu den Zielen der Gesundheitsreform zwischen Kanzlerin Angela Merkel, Vizekanzler Franz Müntefering, den Fraktionsspitzen Peter Struck, Peter Ramsauer und Volker Kauder sowie dem bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber folgte. Dort drehten sich die Gespräche nahezu ausschließlich um den Finanzierungsaspekt (Interview 10). Während die Fachpolitiker die Gemeinsamkeiten in Strukturfragen betonten, wollten sich die Spitzenpolitiker an der Finanzreform messen lassen (Interview 14).
In den Kanzleramtsrunden wurden alle denkbaren Modelle bis hin zur kompletten Steuerfinanzierung diskutiert (Interview 15). Parallel führten Schmidt und Merkel frühzeitig intensive Gespräche (Interview 11). Letztlich fehlte es jedoch lange an gemeinsamen Zielvorgaben der Spitzen (Interview 15). Problematisch waren unter anderem die unterschiedlichen Problemwahrnehmungen, Begriffsverständnisse und Bewertungen kausaler Zusammenhänge (Interview 6; Interview 9; Interview 10; Interview 11).
Bei der Bewertung von Lösungsalternativen spielten dann auch eher macht- als sachpolitische Erwägungen eine Rolle. Obwohl der Gesundheitsfonds begrifflich auf einen wissenschaftlichen Vorschlag zurückging, waren die Entscheidung für das Modell und dessen konkrete Ausgestaltung Ergebnisse politischer Kompromisse auf der parteipolitischen Spitzenebene (Interview 5; Interview 7; Interview 11; Interview 17; Interview 19).
Die wissenschaftliche Beurteilung der Reformvorschläge war verheerend, obwohl sich die Kritik allein auf den Finanzierungsteil bezog. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bezeichnete in seinem Jahresgutachten die Gesundheitsreform auf der Finanzierungsseite als misslungen (Sachverständigenrat 2006: 217). Jürgen Wasem kritisierte in der Bundestagsanhörung den Fonds, da dieser in der Kompromissvariante keine Antwort auf die Einnahmeprobleme der GKV biete und verzichtbar sei (Deutscher Bundestag 2006; Wasem 2006: 2). Der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, Eberhard Wille, bezeichnete an gleicher Stelle den Fonds als Schwachstelle der Reform, da dieser nichts an der Kopplung von Arbeits- und Gesundheitskosten ändere (Deutscher Bundestag 2006).
Insgesamt, so die einhellige Meinung der Experten, sei der Fonds fachlich nicht zu rechtfertigen. Eine höhere Steuerfinanzierung sei ohne den Fonds jederzeit möglich. Der Fonds sei nur eine Hülle und werde als politisches Vehikel genutzt, um den Konflikt um die Finanzierung beizulegen (Interview 2; Interview 4). Allerdings wurde aufgrund des Fonds eine Verhandlungslösung in der Koalition letztlich möglich, da beide Parteien ihr Gesicht wahren konnten (Interview 2; Interview 4).
Die konkrete Formulierung der Strukturreformen wurde nicht von parteipolitischen Spitzen, sondern von Fachpolitikern mit langjähriger Erfahrung im Politikfeld vorgenommen. So wurden zur Sondierung von Lösungsalternativen internationale Vorbilder systematisch ausgewertet (Interview 9; Interview 11; Interview 16). Im Gegensatz zur Aushandlung des Gesundheitsfonds war die Formulierung der Strukturreformen zumindest evidenzorientiert.
Es ist nicht gelungen, einen systematisch entwickelten Reformfahrplan durchzuhalten. Die einzelnen Reformschritte mussten aufgrund tagespolitisch veränderter Machtverhältnisse und anderer situativer Einflüsse wiederholt angepasst werden.
5.2 Vertrauen aufbauen: unrealistische Erwartungen und mangelnde Dialogorientierung
Die kommunikativen Anforderungen an strategische Reformpolitik wurden auch in der Phase der Politikformulierung nicht erfüllt. Hierfür sind vor allem zwei Gründe ausschlaggebend: Im Bereich der Finanzierungsreform fehlte es an den Voraussetzungen für strategische Kommunikation, da lange keine klare inhaltliche Lösung gefunden werden konnte. Auf der Ebene der Fachpolitiker wurde ein Dialog mit den Stakeholdern gezielt vermieden.
Der Großen Koalition gelang es im Rahmen der Gesundheitsreform kaum, Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Ein besonderes Problem lag in der Glaubwürdigkeitslücke bei der Steuerfinanzierung (Interview 1). Diese entstand auch dadurch, dass keine realistischen Erwartungen erzeugt worden waren. Die Reform hat vor allem nicht hervorgebracht, was von der Politik angekündigt worden war: sinkende Beiträge (Interview 8; Interview 13).
Während des gesamten Reformprozesses war die Öffentlichkeit auf die Reform der Finanzstrukturen fixiert. Seitens der Politik wurde in den Koalitionsverhandlungen nochmals die Stabilität der Beiträge als politisches Ziel ausgegeben (CDU, CSU und SPD 2005: 28). Zudem erwartete die Basis beider Volksparteien die Realisierung der jeweils präferierten Instrumente und die Stabilisierung des Beitragssatzes (Interview 5; Interview 7; Interview 13). Allerdings löste die Regierung dieses Ziel nicht ein, sondern beschloss für das Jahr 2007 eine Beitragssatzerhöhung um 0,5 Prozentpunkte. Dies diskreditierte die Reform zusätzlich in der Öffentlichkeit.
Das Ergebnis wurde am Ende falsch kommuniziert: Es wurde als großer Erfolg dargestellt, was es aufgrund der politischen Konstellation ganz offensichtlich nicht sein konnte (Interview 3). Eine Kommunikation als Kompromiss mit Verweis auf die zukünftigen Gestaltungsoptionen des Fonds wäre richtig gewesen (Interview 3; Interview 13). Für Reformkommunikation gilt, nur das Machbare zu kommunizieren bzw. eher geringere Erwartungen zu wecken, als tatsächlich möglich wären (Interview 14).
Das zweite Problem, eine gezielte Vermeidung eines Dialogs mit den Stakeholdern, geht vor allem auf vorhergehende Erfahrungen der Fachebene zurück. Das BMG ging davon aus, dass jede positive Reformkommunikation aufgrund der überlegenen Gegenkommunikation durch Interessenverbände zum Scheitern verurteilt wäre (Interview 1; Interview 12). Reformkommunikation bedarf aus Sicht der Fachpolitiker eines aufnahmefähigen Umfelds, das nicht gegeben war (Interview 18).
Noch weniger etabliert ist ein Dialog mit den Bürgern. In der deutschen Gesundheitspolitik fehlt jede systematische Rückbindung an die Interessen der Versicherten und Patienten. Zwar beanspruchen fast alle Akteure, Vertreter eines Gemeinwohls der Bürger zu sein. Selbst auf die Politik der Selbstverwaltungsgremien in den Krankenversicherungen haben die Bürger jedoch kaum Einfluss, zumal die Bestimmung der Versichertenvertreter in fast allen Krankenkassen über Friedenswahlen ohne eigentliche Wahlhandlung stattfindet. Eine direkte Einbindung von Bürgerinteressen über Bürgerforen oder andere Elemente direkter Beteiligung steht den zahlreichen Interessen der organisierten Interessengruppen in diesem Politikfeld entgegen.
Ein übergreifendes Problem war das Framing der Reform durch den Gesetzesnamen »Wettbewerbsstärkungsgesetz«. Hier wurde zu wenig auf eine klare und positive Reformsprache geachtet. Denn Wettbewerb ist kein ausschließlich positiv besetzter Begriff. Außerdem erschweren die unterschiedlichen Wettbewerbsverständnisse der beteiligten Akteure einen offenen Reformdialog. Die Wahl des Namens wurde nicht mit den Kommunikationsexperten im BMG abgestimmt (Interview 18). Alternativen – etwa »Qualitätsstärkungsgesetz« – wurden nicht breit diskutiert.
Kontraproduktiv wirkte zudem die Darstellung des Fonds als wesentlicher Reformschritt: Statt den Gesundheitsfonds als Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs und realistischen Kompromiss darzustellen, wurde so die Möglichkeit für Kritiker eröffnet, das Modell als Bürokratiemonster zu bezeichnen (exemplarisch Spitzenverbände der Krankenkassen 2006).
5.3 Mehrheiten sichern: erfolgreiche Verhandlungen zu Lasten der Qualität?
Bei der Auswahl des Reformweges ist wiederum zwischen der Finanzreform und der Strukturreform zu differenzieren. Die Finanzreform war weitgehend das Ergebnis einer konsensorientierten Verhandlungsstrategie. Im Gegensatz zur vorherigen Verhandlung zum Gesundheitsmodernisierungsgesetz waren beide Verhandlungsseiten an einem Ergebnis interessiert. Als Koalitionspartner musste auch die Unionsführung anders als 2003 einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen anstreben. Angesichts der gegensätzlichen Zielorientierung spielte sachorientiertes Argumentieren dabei jedoch kaum eine Rolle. Vielmehr ging es darum, durch Tauschgeschäfte Lösungen zu finden, die von allen zentralen Akteuren getragen werden konnten.
Im Mittelpunkt dieser Tauschprozesse standen der Risikostrukturausgleich, die Ausgestaltung des Zusatzbeitrags der Versicherten und vor allem die Zukunft der PKV (Interview 11). Zudem trafen die unterschiedlichen Zielvorstellungen der Koalitionsparteien in der Frage der Beitragsparität aufeinander (Interview 10; vgl. Ferner 2007; Velter 2007). Auf beiden Seiten standen die Verhandlungspartner unter internem Druck. Die Union war zunehmend damit konfrontiert, dass sich die bayerische Landesregierung für die Interessen der PKV einsetzte. Bayern ist Standort großer Versicherungsunternehmen. Zudem war die Machtfrage um den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber ungeklärt.
Für die SPD-Führung war die Parlamentarische Linke die größte Herausforderung. Es musste eine Lösung gefunden werden, in der sich die Solidaritätsziele der Linken ausreichend wiederfanden. Wichtigste Elemente waren vor allem die Belastungsobergrenze beim Zusatzbeitrag (Interview 15) und der Risikostrukturausgleich (Interview 10; Interview 19). Auch in der SPD bildeten interne Machtkämpfe den Hintergrund für inhaltliche Auseinandersetzungen. Vor allem das Spannungsfeld um den bundespolitisch wenig etablierten neuen Parteivorsitzenden Kurt Beck und die wachsende Konkurrenz durch die Linkspartei engten den Verhandlungsraum ein.
Erste Details für den Fonds wurden am 5. Oktober 2006 im Koalitionsausschuss festgelegt (Interview 10; Merkel, Beck und Stoiber 2006): Zunächst wurde die soziale Flankierung des Fonds gegen die Nichteinbeziehung der PKV getauscht. Für die PKV war nun ein Basistarif vorgesehen, zu dem nur PKV-Versicherte Zugang haben sollten. Der PKV-Kompromiss geht dabei auf ein Papier der CSU zurück, das nahezu gänzlich übernommen wurde (Interview 19). In der GKV sollte zudem der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich (morbiRSA) eingeführt werden. Bayerischen Bedenken bezüglich einer starken finanziellen Belastung der dort ansässigen Kassen wurde durch die Konvergenzklausel begegnet. Diese soll die Umverteilungen zu Lasten der Kassen eines Bundeslandes auf 100 Millionen Euro jährlich begrenzen.
Trotz der intensiven Beteiligung am bisherigen Gesetzgebungsprozess meldete die Union Ende 2006 wieder massive Bedenken gegenüber dem PKV-Kompromiss an. Im Januar 2007 wurde deshalb erneut zwischen Union und SPD ein Kompromiss zur PKV verhandelt. Die Änderungen fielen nun moderater aus, dafür wurde im Austausch eine endgültige Versicherungspflicht für alle Bürger eingeführt. Im Koalitionsausschuss wurde zudem eine Erhöhung des Steuerzuschusses für 2008 und 2009 um eine weitere Milliarde Euro jährlich festgesetzt.
Nachverhandlungen machten auch die 104 Änderungsanträge erforderlich, die der Bundesrat am 15. Dezember 2006 in seiner Stellungnahme zu dem Gesetz formulierte (Bundesrat 2006). Die Änderungsanträge waren zum größten Teil durch landespolitische Interessen bedingt und betrafen Elemente der Strukturreform. Die Bundesregierung lehnte sie allerdings fast alle ab (Deutscher Bundestag 2007). Lediglich 20 Anträge führten zu Änderungen des Gesetzentwurfes. Hierbei handelte es sich vorwiegend um parteipolitisch kontroverse Aspekte ohne direkten Bezug zu Landesinteressen (Aßhauer 2008: 65 – 67).
Im Umgang mit den Bundesländern verfolgte die Regierung somit zu diesem Zeitpunkt eine stärker konfliktorientierte Verhandlungsstrategie als in der zwischenparteilichen Auseinandersetzung. Unter dem Gesichtspunkt des Sicherns von Mehrheiten war diese Strategie erfolgreich, da einzelne Issues nur in wenigen Fällen die Ablehnung eines gesamten Gesetzentwurfes durch ein Bundesland legitimieren können (in diesem Fall nur beim Freistaat Sachsen) und im Bundesrat letztlich die parteipolitische Disziplin ausreichend war.
Im Gegensatz zur Finanzreform wurde bei den Strukturfragen zumindest phasenweise eine problemorientierte Verhandlungsstrategie mit der Suche nach optimalen Lösungen gewählt. Bei den Verhandlungen zur Strukturreform dominierte die Arena der Fachpolitiker. Auf Basis der Eckpunkte vom Juli 2006 erarbeitete eine verkleinerte Arbeitsgruppe einen ersten Entwurf. Bis zur Fertigstellung der Eckpunkte waren auf beiden Seiten immer zehn bis elf Personen an den Arbeitsgruppensitzungen beteiligt. Danach wurde die Zahl der beteiligten Personen noch weiter reduziert. Teile vor allem der Strukturreform wurden letztlich bilateral auf der Fachebene ausgehandelt und formuliert (Interview 10; Interview 11).
Während die Verhandlungen auf der politischen Fachebene problemorientiert verliefen, wählte die Politik gegenüber den Interessenverbänden weitgehend eine konfliktorientierte Verhandlungsstrategie. Es wurde keine Möglichkeit gesehen, die Interessenverbände für die Reform als Bündnispartner zu gewinnen (Interview 3; Interview11). Ziel war es daher, den Primat der Politik gegenüber den Verbänden wiederherzustellen (Interview 4).
Insgesamt lassen sich also alle drei idealtypischen Verhandlungsstile bei der Politikformulierung wiederfinden. Die Verhandlungen waren einerseits erfolgreich, da ausreichende Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat zur Gesetzesformulierung gewonnen werden konnten. Andererseits ist es nicht gelungen, öffentlichen Rückhalt für die Reform zu sichern.
Inhaltlich führte das GKV-WSG zumindest nicht zu kurzfristig spürbaren negativen Effekten für die Bevölkerung. Insofern wurde der Fehler der mit dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz eingeführten Praxisgebühr nicht wiederholt. Die Reform enthält jedoch auch keine direkt spürbaren positiven Effekte. Hier wurde insbesondere im Bereich der Qualitätssicherung die Chance vertan, kurzfristig öffentlich sichtbare Maßnahmen zu integrieren. Insofern stellt sich die Trennung der Verhandlungsarenen als zentrales Problem der Reform dar. Sie führte dazu, dass bei der Finanzreform inhaltliche Aspekte vernachlässigt wurden, während bei der Strukturreform die Machtinteressen der beteiligten Parteien unzureichend Berücksichtigung fanden.
5.4 Erfolgskontrolle bei der Politikformulierung: bekannte Defizite
Die Politikformulierung war noch stärker als das Agenda-Setting von einer Vernachlässigung des Stakeholder-Dialogs und einer Ausgrenzung der Stakeholder und externer Sachverständiger geprägt (Interview 2; Interview 4; Interview 6; Interview 7). Politisches Lernen fand sich bei der Aushandlung des Gesundheitsfonds nur in Bezug auf die Durchsetzbarkeit von Entwürfen. Lediglich die interne Kritik von Fachpolitikern am unterentwickelten Steueranteil wurde berücksichtigt. So wurde der Zuschuss um eine Milliarde Euro erhöht. Er blieb jedoch mit 2,5 Milliarden Euro noch niedriger als die insgesamt fünf Milliarden umfassenden zusätzlichen Defizite durch die Beschlüsse der Koalitionsverhandlungen.
In den verschiedenen Arenen dominierten unterschiedliche Verhandlungsstile (vgl. Tabelle 3). Eine systematische Erfolgskontrolle wurde jedoch in keinem Teilbereich angestrebt. Die Akteure waren jeweils auf eine möglichst vollständige Durchsetzung ihrer Ziele konzentriert und in dieser Phase nicht (mehr) offen für externe Informationen.
6 Politikumsetzung: anti-partizipatorischer Ansatz
6.1 Ergebnisqualität sichern: unbeabsichtigte Nebenwirkungen als möglicher Störfaktor
Die Sicherung der Ergebnisqualität ist bei Gesundheitsreformen besonders problematisch. Die Erreichung der letztlich verfolgten inhaltlichen Ziele (Finanzierbarkeit, Solidarität, Wachstum und Qualität) hängt nicht allein von dieser Reform ab. Sowohl bei der Verwirklichung der Strukturreform als auch bei der Umsetzung des Gesundheitsfonds bestehen Probleme und Umsetzungshindernisse.
Die Stärkung des Wettbewerbs durch die Strukturreform wurde zwar im Hinblick auf rechtliche Vorgaben weitgehend gesichert. Eine Sicherstellung der Wirkungsorientierung scheitert jedoch an den Einflüssen der Stakeholder in der Umsetzungsphase. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt deuten sich mögliche unbeabsichtigte Nebenwirkungen an, die späteres Nachsteuern in weiteren Reformschritten notwendig machen können.
Dabei verläuft die Umsetzung der Strukturreformen auf unterschiedlichen Ebenen. Auf Bundesebene hat das BMG die Möglichkeit zur direkten Kontrolle über die Entwicklung der neuen verbandlichen Struktur der Krankenkassen und die Weiterentwicklung des gemeinsamen Bundesausschusses. Es ist jedoch umstritten, inwiefern die Ausweitung zentraler Vorgaben bei der Fixierung der Leistungskataloge und Qualitätskriterien den gleichzeitig angestrebten Wettbewerb einschränken. Schon vor der Reform wurden nur acht Prozent der Kassenausgaben auf Grundlage individueller Verträge der einzelnen Kassen festgelegt (Sachverständigenrat 2005: 36).
Auf regionaler Ebene besteht das Risiko der Entstehung neuer Monopole. Bisher sind die durch das GKV-WSG angestoßenen Entwicklungen in den Regionen uneinheitlich. Die neuen gesetzlichen Optionen werden in Süddeutschland stärker genutzt als in Nord- und Ostdeutschland. Eine Vorreiterrolle nimmt bisher Baden-Württemberg ein. Hier hat die AOK einen Selektivvertrag mit dem Ärzteverbund MEDI und dem Hausärzteverband geschlossen (Ärzte Zeitung 9.5.2008).
Die ärztlichen Vertragsparteien standen bei der Ausschreibung in Konkurrenz unter anderem zur Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (Ärzte Zeitung 13.12.2007). Gleichzeitig verfügen MEDI und der Hausärzteverband jedoch über eine Mehrheit in der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung. Es ist also die problematische Situation entstanden, dass ein Zusammenschluss von Ärzteverbänden starken Einfluss auf die Entscheidungen seines wichtigsten Konkurrenten nehmen kann. Bisher ist es offen, ob langfristig andere Anbieter in Baden-Württemberg zu einer ernsthaften Konkurrenz für MEDI und den Hausärzteverband werden.
Neben der Bildung neuer Monopole ist auch denkbar, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen ihr traditionelles Monopol trotz der rechtlichen Veränderungen behaupten können. Um dieses Monopol zu brechen, müssten 70 Prozent der Ärzte einer Fachgruppe oder Region ihre Zulassung zur Beteiligung an der kassenärztlichen Versorgung freiwillig zurückgeben. Ernsthafte Bemühungen, diese Quote zu erreichen, gab es bisher durch ein Korbmodell des Hausarztverbandes in Bayern. Die Resonanz reichte jedoch bisher nicht aus, um den Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigung in Bayern zu brechen (Ärzte Zeitung 19.5.2008).
Bei der Verwirklichung des Gesundheitsfonds liegen die Probleme bisher in der unzureichenden operationalen Definition der Konvergenzklausel und der konkreten Fassung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs. Die politisch begründete, spät durchgesetzte und unzureichend abgestimmte Konvergenzklausel hat sich bereits als Grundlage für politische Konflikte erwiesen.
Bei der Formulierung der Liste für ausgleichsfähige Krankheiten im Rahmen des neuen Kassenartenausgleichs gab es ebenso Streitpunkte. Die sechs Sachverständigen des mit der Formulierung der 80 ausgleichsfähigen Krankheiten beauftragten Beirats beim Bundesversicherungsamt traten zurück, da es Konflikte um die wissenschaftliche Unabhängigkeit bei der Listenerstellung gab.
Auch hier droht die Wirkungsorientierung an unbeabsichtigten Nebenwirkungen zu scheitern. Der morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich kann Anreize für einzelne Krankenkassen oder Kassengruppen setzen, sich nicht durch effizientes Wirtschaften, sondern durch politische Einflussnahme auf den Ausgleichsmechanismus Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Dies wurde von ehemaligen Mitgliedern des Beirats beim Bundesversicherungsamt zunächst der AOK unterstellt. Eine mögliche Spezialisierung einzelner Kassen auf spezielle Versichertengruppen würde entsprechende Anreize für die Kassen verstärken. Je stärker die Versichertenstruktur einer Kasse eine überproportionale Vertretung einer Krankheit aufweist, desto größer wird in Zukunft die Abhängigkeit des Erfolgs dieser Kasse von der Bewertung dieser Krankheit durch den neuen Risikostrukturausgleich.
Mittelfristig kann die Umsetzung noch mit Problemen der Unterfinanzierung konfrontiert werden. Neben einer Lösung für eine mögliche Unterfinanzierung in Folge der Konvergenzklausel ist auch die Kostendeckung für die fünf Prozent der Ausgaben ungeklärt, die nicht durch den Gesundheitsfonds gesichert sind. Angesichts der Deckelung des Zusatzbeitrags auf ein Prozent der Einkommen deutet sich hier für viele Kassen ein Finanzierungsproblem an. Langfristige Umsetzungsprobleme betreffen vor allem das Risiko beider Reformparteien, dass bei veränderten Mehrheitsverhältnissen eine Weiterentwicklung des Fonds in eine von ihnen jeweils nicht gewünschte Richtung erfolgen kann.
Während also die Wirkungsorientierung unklar ist, wurden die Umsetzungsschritte genau festgelegt. Wesentliche Bestandteile der Reform können ohne Mitwirkung der Interessenverbände und ohne erneute Zustimmung des Bundesrates nach festem Zeitplan umgesetzt werden.
Bei der Wahl der Steuerungsinstrumente verbindet das GKVWSG regulative Instrumente auf zentraler Ebene mit Anreizinstrumenten für Leistungsanbieter und Versicherte (Böckmann 2007). Wie diese Instrumente im Einzelnen wirken werden, ist noch nicht absehbar. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Umstellung der Finanzierung durch den Gesundheitsfonds stärkeren Druck auf die Kassen bewirken wird.
Für die Versicherten besteht die Veränderung vor allem darin, dass der einheitliche Beitragssatz in Zukunft die Arbeitgeber von Beitragsunterschieden zwischen den Kassen ausnimmt. Diese können für die Versicherten in Form der Zusatzprämien weiter bestehen. Sie sind dann besser sichtbar, da sie direkt in Euro-Werten und nicht in Beitragssätzen ausgewiesen sind und zusätzlich erhoben werden müssen. Es ist also zu erwarten, dass die Versicherten größere Transparenz über die Kostenunterschiede zwischen den Kassen erlangen und daher eher bereit sein werden, teurere Kassen zu verlassen.
Auch bei den Leistungsanbietern werden sich die finanziellen Anreize verstärken. Ab 2009 sollen die Punktwerte der niedergelassenen Ärzte durch eine Euro-Gebührenordnung ersetzt werden. Damit wird zumindest ein Teil des Morbiditätsrisikos von den Ärzten auf die Kassen verlagert. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die Kassen den steigenden Kostendruck in den Vertragsverhandlungen an die Leistungsanbieter weitergeben.
Die finanziellen Anreize für die beteiligten Akteure werden somit voraussichtlich zu wesentlichen Änderungen im System führen. Ob sich diese Änderungen jedoch tatsächlich in einem Wettbewerb um Qualität und Wirtschaftlichkeit niederschlagen werden, ist noch nicht absehbar.
6.2 Bürgernähe herstellen: Transparenzmängel
Wie in vorherigen Reformphasen ist auch bei der Politikumsetzung keine Bürgernähe gesichert. Die Vorgängerreform, das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) von 2003, beinhaltete Maßnahmen zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Bürgern und Politik. So wurde eine Patientenbeauftragte des Deutschen Bundestages eingesetzt. Außerdem integrierte das GMG erstmals Patientenverbände in die zentralen Verhandlungsgremien, indem diese am Gemeinsamen Bundesausschuss beteiligt wurden. Allerdings billigt das GMG den Patientenvertretern kein Stimmrecht zu.
Das GKV-WSG führt diese Strategie nicht in gleichem Ausmaß fort. So verweigert es den Patientenverbänden weiterhin ein Stimmrecht. Grundlage ist unter anderem die Einschätzung der Ministerialbürokratie, dass die Patientenvertreter sich zum Sprachrohr für die Pharmaindustrie entwickelt hätten (Interview 1). Diese Einschätzung wird durch eine Studie gestützt, die von Beratern der Gesundheitsministerin verfasst wurde (Schubert und Glaeske 2006).
Auch die Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung wurde durch die fehlende Stärkung der Patientenverbände nicht verbessert. Die Verwaltung des Gesundheitswesens ist für die Bürger undurchsichtig. Neben der Gemeinsamen Selbstverwaltung spielen hier die Selbstverwaltungsorgane der Krankenkassen eine zentrale Rolle. Die Kassen sehen sich zwar als Sprachrohr der Bürger. Tatsächlich ist die Beteiligung der Bürger in der Selbstverwaltung beschränkt (Braun et al. 2008).
Auch die unmittelbare Staatsverwaltung, repräsentiert durch Landesbehörden einerseits und die Nachfolgeorganisationen des früheren Bundesgesundheitsamtes andererseits, hat keinen direkten Kontakt zur Bevölkerung etabliert. Im GKV-WSG fehlen Ansätze, die Übersichtlichkeit für die Bevölkerung zu verbessern und klare Verantwortlichkeiten bei der Umsetzung zu benennen.
Angesichts der Unübersichtlichkeit der Verantwortung für die Politikumsetzung können transparente Abläufe kaum gewährleistet werden. In der Bevölkerung sind die Kenntnisse über die Reform gering. Selbst bei den Stakeholdern herrscht Ungewissheit über die Auswirkungen der Reformmaßnahmen (Ärzte Zeitung 2.6.2008).
6.3 Umsetzungsakteure aktivieren: gezielte Ausgrenzung statt Einbindung
Die Umsetzungsakteure stellen traditionell ein zentrales Problem für Gesundheitsreformen dar. Das Beispiel der bereits zweifach gescheiterten Einführung einer Positivliste für erstattungsfähige Arzneimittel zeigt, dass es den Stakeholdern mit entsprechender politischer Unterstützung gelingen kann, Reformelemente noch in der Umsetzungsphase zu stoppen (Bandelow 1998: 211). Andererseits bietet etwa die ebenfalls mit einer Konfrontationsstrategie 1992 durchgesetzte Organisationsreform der gesetzlichen Krankenkassen ein Fallbeispiel für die Überwindung von Widerständen der Stakeholder auch in der Umsetzungsphase (Bandelow 1998: 210).
Grundsätzlich ist der Umgang mit den Stakeholdern aus zwei Gründen für die Umsetzung relevant: Sie stellen einerseits notwendigen Sachverstand bereit und bieten andererseits politische Legitimation. Sachverstand benötigt die Politik unter anderem von Ärzten. Diese waren bis Anfang der 90er Jahre in einem Netzwerk von Verbänden mit interner Arbeitsteilung und zentralistischer Entscheidungsstruktur organisiert. Die Führung der Ärzteverbände verfügte somit über ein Monopol ärztlicher Beratungskompetenz, das bei fehlender Kooperationsbereitschaft der Politik verweigert werden konnte.
Die Gesundheitsreformen der letzten Jahre hatten eine grundlegende Veränderung der ärztlichen Interessenorganisation zur Folge. Die Verbandslandschaft hat sich ausdifferenziert und die Interessen wurden weiter fragmentiert. Die Ausdifferenzierung betrifft unter anderem Ärztegenossenschaften, die als Parallelorganisationen zu den Kassenärztlichen Vereinigungen entstanden sind, um in den Verhandlungen für Selektivverträge als Gegengewicht zu den Kassen zu wirken. Die Fragmentierung wiederum ist Folge der Kostendämpfungspolitik. Diese hatte Verteilungskonflikte und damit verstärkte innerärztliche Konflikte zur Folge. Insbesondere die Konkurrenz zwischen Hausärzten und Fachärzten wurde durch die Reformen systematisch verstärkt (Ärzte Zeitung 25.6.2007).
Durch die Pluralisierung der Ärzteverbände ist es für einzelne Verbandsvertreter schwieriger geworden, monopolisierten Sachverstand als politische Ressource zu nutzen. Ähnlich wie in Frankreich können Politik, Verwaltung und Kassen zunehmend zwischen alternativen Ansprechpartnern wählen (Bandelow und Hassenteufel 2007).
Politische Legitimation wird als zentrale Ressource der Stakeholder seit den gescheiterten blankschen Reformversuchen der 60er Jahre gesehen. Ärzte können als Multiplikatoren wirken und ihr hohes Renommee nutzen, um die öffentliche Meinung für oder gegen die Regierungsparteien zu beeinflussen. Hier hat allerdings die Erfahrung mit dem Gesundheitsstrukturgesetz 1992 gezeigt, dass formelle oder informelle Große Koalitionen den Einfluss der Stakeholder nachhaltig beschränken (Interview 10). Es fehlt die Möglichkeit, eine alternative Wahlempfehlung gegen die Regierungsparteien anzudrohen.
Vor diesem Hintergrund verfolgt das GKV-WSG gezielt einen anti-partizipatorischen Ansatz. Die Kernexekutive grenzte sowohl die Leistungsanbieter als auch die Krankenkassenverbände bzw. die dort vertretenen Tarifparteien bei allen Reformphasen so weit wie möglich aus. Das BMG ist bemüht, Informationen nicht von den traditionellen Verbänden, sondern möglichst aus anderen Quellen zu erhalten (z. B. von wissenschaftlichen Beiräten). Details der Umsetzung wurden der Verantwortung der Stakeholder entzogen.
So wurde etwa die Festsetzung des Beitragssatzes für alle Kassen bei der Einführung des Gesundheitsfonds 2009 bewusst mit einer nicht zustimmungspflichtigen Rechtsverordnung ermöglicht (Interview 1). Diese Strategie einer möglichst unveränderten Umsetzung der verabschiedeten Maßnahmen zeigte sich auch im Umgang mit der Konvergenzklausel.
Diese wurde im April 2008 zu einem erneuten Politikum, nachdem durch eine Veröffentlichung in der Tageszeitung »Die Welt« die Ergebnisse eines von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Gutachtens bekannt wurden (Die Welt 8.4.2008). Die Gesundheitsökonomen Jürgen Wasem, Florian Buchner und Eberhard Wille sehen demnach durch die Konvergenzklausel die Gefahr einer Unterfinanzierung. In der Folge stellten Vertreter süddeutscher Landesregierungen und Oppositionspolitiker den Gesundheitsfonds in Frage. Die Bundesregierung reagierte darauf mit wiederholten Bestätigungen der Absicht, den Fonds unverändert und pünktlich umzusetzen.
Die Einbindung der Verwaltung konzentriert sich bei der Umsetzung auf die unmittelbare Staatsverwaltung auf Bundesebene. Das BMG hat bei allen zentralen Reformteilen die Federführung. Gegenüber dem BMG ist keine politische Motivation notwendig, da die Bundesverwaltung selbst Initiator wesentlicher Reformteile war. Dagegen lässt sich keine Strategie der Stärkung einer systematischen Abstimmung mit den Landesverwaltungen und der mittelbaren Selbstverwaltung bei der Umsetzung des GKV-WSG beobachten.
Die Zentralisierung von Entscheidungskompetenzen beim BMG schafft zunächst klare Verantwortlichkeiten für die Umsetzung. Allerdings sind die Ziele der Reform unklar. Die ursprüngliche Zielsetzung der Senkung und Stabilisierung der Beitragssätze wurde bereits während der Politikformulierung aufgegeben. Für das BMG ist die Stärkung der Qualität das wichtigste Ziel. Hier nutzt das Ministerium systematischen Best-Practice-Austausch unter anderem durch die vergleichenden Daten des Gesundheitsmonitors der Bertelsmann Stiftung (Interview 1). Allerdings fehlt eine politische Kontrolle für die Erreichung quantifizierbarer Zielvorgaben zur Qualitätssicherung.
6.4 Erfolgskontrolle bei der Politikumsetzung: keine systematische Bewertung
Eine systematische Erfolgskontrolle des GKV-WSG ist nicht vorgesehen. Das BMG sieht sich zwar für die Gesetzesformulierung zuständig, überwachte bisher jedoch kaum den Implementationsprozess in der Selbstverwaltung (Interview 10; Interview 11). Es gibt keine Debatte über geeignete Evaluationstechniken bei der Umsetzung der Gesundheitsreform. Der Einfluss des strategischen Machtzentrums konzentriert sich in dieser Frage darauf, durch die Formulierung des Gesetzes eine möglichst reibungslose Politikumsetzung zu gewährleisten.
Eine systematische prozessbegleitende Evaluation findet nicht statt. Auch eine systematische Bewertung von Gesamtkosten und -nutzen ist nicht vorgesehen. Politisches Lernen wurde von den Akteuren vor allem im Hinblick auf ihre jeweiligen Durchsetzungsstrategien angestrebt. Lernprozesse im Hinblick auf die Umsetzung zukünftiger Reformen sind noch nicht absehbar.
Die öffentliche Resonanz des GKV-WSG war sehr negativ. Dies nahmen die Akteure der Kernexekutive auch wahr. Sie sahen jedoch keine Möglichkeit, dies systematisch zu ändern (Interview 1). Auch durch einen verbesserten Stakeholder-Dialog sei keine breitere Reformunterstützung zu gewinnen (Interview 10). Entsprechend liegen keine zielgruppenspezifisch nutzbaren Evaluationsergebnisse vor.
Flexibles Nachsteuern sollte gezielt vermieden werden, um Vetospielern nicht die Möglichkeit zur Verhinderung von Reformelementen zu geben (Interview 11). Veränderte Akteurskonstellationen werden dagegen systematisch berücksichtigt. Diese sind teilweise eine direkte Folge des Gesetzes, wie die Einrichtung des Spitzenverbandes Bund der Gesetzlichen Krankenkassen. Andere Veränderungen beruhen indirekt auf Maßnahmen des Gesetzes, wie etwa die Pluralisierung der Verbände von Leistungserbringern. Das BMG versucht die veränderten Konstellationen zu nutzen, um langfristig eigene Handlungsspielräume auszuweiten.
Bisher wurden die im SPR formulierten Kriterien der Erfolgskontrolle bei der Umsetzung fast alle nicht erfüllt (vgl. Tabelle 4). Inwiefern dies zu Defiziten der strategischen Reformpolitik führt, lässt sich jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehen.
7 Fazit
Die Gesundheitsreform der Großen Koalition zeichnet sich durch die Gleichzeitigkeit von Scheitern und Erfolg aus. In der Finanzreform wurden weder die angekündigten Beitragssatzsenkungen noch die postulierten Modelle verwirklicht. Andererseits beinhaltet das GKV-WSG eine Strukturreform, die noch 2003 an der Union gescheitert und auf den erbitterten Widerstand der Interessenverbände gestoßen war.
In der Gesundheitspolitik stand die Kernexekutive vor einer hochkomplexen Ausgangslage. Es wurden frühzeitig strategische Fehler begangen, die den Reformprozess prägten. Vor allem in der Finanzierungsfrage hat sich der direkte Einfluss der Parteispitzen als kontraproduktiv erwiesen. Parteispitzen orientieren sich primär am Ziel der (kurzfristigen) Stimmenmaximierung. In der speziellen Situation einer Großen Koalition ist angesichts der direkten Konkurrenz zwischen den Verhandlungspartnern das Risiko besonders groß, dass Konflikte offen ausgetragen werden.
Die zentrale Rolle der Parteispitzen erschwerte problemorientierte Verhandlungen. Vor allem die strategische Dimension der Kompetenz wurde bei der Konzeption des Gesundheitsfonds vernachlässigt. Allerdings ist es der SPD im Gegensatz zur Union gelungen, mit Ministerin Schmidt eine klare Leadership-Position zu etablieren. Kennzeichen des Reformprozesses ist vor allem ein gänzlich fehlgeschlagenes Erwartungsmanagement. Die Gesundheitsreform der Großen Koalition war durch den Bundestagswahlkampf belastet. In der Wahlauseinandersetzung antizipierten die Parteien die Problematik einer späteren Großen Koalition nicht. Die Ankündigung von Beitragssatzsenkungen und einer grundlegenden Umstrukturierung der Finanzierungsbasis war gleichermaßen unrealistisch.
Die Stilisierung einer Unvereinbarkeit der Reformmodelle unterminierte im Voraus mögliche Kompromisslinien. Ungeachtet der politischen Debatte blieben die Reformpläne beider Parteien nur Stückwerk. Nachhaltige Gesundheitspolitik sollte dagegen Reformkonzepte bereits in der Mitte von Wahlperioden auf die Agenda setzen und wesentliche Gemeinsamkeiten außerhalb von Wahlkampfzeiten ausloten. Ohnehin ist der gesamte Reformprozess durch Kommunikationsfehler gekennzeichnet, die vor allem das Framing betreffen. Es wurde versäumt, die konsensuale Botschaft einer Qualitätssteigerung ausreichend zu platzieren.
Einen weiteren grundlegenden Mangel stellt die fehlende Tradition einer systematischen begleitenden Evaluation dar. Reformakteure stehen beim Agenda-Setting und bei der Politikformulierung vor dem Problem, dass bereits verabschiedete Maßnahmen in der Umsetzungsphase mit anderen Akteuren konfrontiert werden. Hier schlägt sich vor allem die Besonderheit der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen nieder. Das GKV-WSG beinhaltet mit seiner Strukturreform unter anderem den Versuch, diese Reformhürde durch eine Einschränkung der Spielräume der körperschaftlichen Selbstverwaltungsorgane abzusenken.
Im Gegensatz zur Finanzierungsreform weist die Strukturreform Elemente erfolgreicher Reformpolitik auf (Tabelle 5). Es wurde ein handlungsfähiges strategisches Machtzentrum etabliert, das viel Erfahrungswissen in sich vereinte. Dieses war klein genug, um handlungsfähig zu sein, und vertraut genug, um einen problemorientierten Verhandlungsstil auszubilden. Bei der Konzeption der Strukturreform wurden sowohl Erfahrungen aus früheren Reformen als auch aus internationalen Vergleichen und sogar aus dem laufenden Reformprozess integriert.
Zwischen dem Erfolg der Strukturreform und der gescheiterten Finanzreform bestehen trotz der weitgehend getrennten Verhandlungsarenen systematische Zusammenhänge. Die Finanzreform war geeignet, die öffentliche Aufmerksamkeit weitgehend zu binden. Hierdurch wurde die Entscheidungsfindung für eine Strukturreform zumindest erleichtert – und vielleicht auch erst ermöglicht. Aus dem GKV-WSG lassen sich daher keine allgemeingültigen Schlüsse für eine zusammenhängende Konzeption erfolgreicher Reformstrategien ziehen. Der Reformprozess bietet jedoch umfassendes Anschauungsmaterial für erfolgreiche und gescheiterte Strategieelemente und kann so als vielfältige Grundlage für strategische Lernprozesse dienen.
Behandelte Themen
Downloads der Fallstudie
- »Abspaltung der Hausärzte von der KBV eingeläutet«. Ärzte Zeitung 25.6.2007.
- »AOK-Hausarztvertrag verschlankt Bürokratie«. Ärzte Zeitung 9.5.2008.
- Aßhauer, Michael. Parteienwettbewerb in der Gesundheitspolitik – Die Gesundheitsreformen 2004 und 2007 im Vergleich. Magisterarbeit. Braunschweig 2008.
- Bandelow, Nils C. Gesundheitspolitik. Der Staat in der Hand einzelner Interessengruppen? Opladen 1998.
- Bandelow, Nils C. »Ist das Gesundheitswesen noch bezahlbar? Problemstrukturen und Problemlösungen«. Gesellschaft – Wirtschaft – Politik (51) 1 2002. 109 – 131.
- Bandelow, Nils C. »Chancen einer Gesundheitsreform in der Verhandlungsdemokratie«. Aus Politik und Zeitgeschichte 33/34 2003a. 14 – 20.
- Bandelow, Nils C. »Policy Lernen und politische Veränderungen«. Lehrbuch der Politikfeldanalyse. Hrsg. Klaus Schubert und Nils Bandelow. München 2003b. 289 – 330.
- Bandelow, Nils C. »Akteure und Interessen in der Gesundheitspolitik: Vom Korporatismus zum Pluralismus?« Politische Bildung (37) 2 2004a. 49 – 63.
- Bandelow, Nils C. »Governance im Gesundheitswesen: Systemintegration zwischen Verhandlung und hierarchischer Steuerung«. Governance und gesellschaftliche Integration. Hrsg. Stefan Lange und Uwe Schimank. Wiesbaden 2004b. 89 – 107.
- Bandelow, Nils C. Kollektives Lernen durch Vetospieler? Konzepte britischer und deutscher Kernexekutiven zur europäischen Verfassungsund Währungspolitik. Modernes Regieren: Schriften zu einer neuen Regierungslehre. Band 1. Baden-Baden 2005.
- Bandelow, Nils C. »Gesundheitspolitik: Zielkonflikte und Politikwechsel trotz Blockaden«. Regieren in der Bundesrepublik Deutschland. Hrsg. Manfred G. Schmidt und Reimut Zohlnhöfer. Wiesbaden 2006. 159 – 176.
- Bandelow, Nils C. »Ärzteverbände: Niedergang eines Erfolgsmodells?« Interessenverbände in Deutschland. Hrsg. Thomas von Winter und Ulrich Willems. Wiesbaden 2007a. 271 – 293.
- Bandelow, Nils C. »Health Policy: Obstacles to Policy Convergence in Britain and Germany«. German Politics (16) 1 2007b. 150 – 163.
- Bandelow, Nils C. »Der Dritte Weg in der britischen und deutschen Gesundheitspolitik: Separate Reformpfade trotz ideologischer Nähe?« Zeitschrift für Sozialreform (53) 2 2007c. 127 – 145.
- Bandelow, Nils C., und Anja Hartmann. »Weder Rot noch Grün. Machterosion und Interessenfragmentierung bei Staat und Verbänden in der Gesundheitspolitik«. Ende des rot-grünen Projektes. Eine Bilanz der Regierung Schröder 2002 – 2005. Hrsg. Christoph Egle und Reimut Zohlnhöfer. Wiesbaden 2007. 334 – 354.
- Bandelow, Nils C., und Patrick Hassenteufel. »Mehrheitsdemokratische Politikblockaden und verhandlungsdemokratischer Reformeifer: Akteure und Interessen in der französischen und deutschen Gesundheitspolitik«. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (SH 46) 2007. 320 – 342.
- Bertelsmann Stiftung. Gesundheitsmonitor 2004: Die ambulante Versorgung aus Sicht von Bevölkerung und Ärzteschaft. Gütersloh 2004. Bertelsmann Stiftung. »Politische Reformkommunikation. Veränderungsprozesse überzeugend vermitteln«. Diskussionspapier zum Expertendialog vom 16. November 2006. Gütersloh 2006.
- Böckmann, Roman. »Von der Selbstverwaltung zum regulierten Gesundheitsmarkt«. PoliThesis. Diskussionspapiere des Instituts für Politikwissenschaft und der Graduate School of Politics (GraSP). Münster 2007.
- Braun, Bernard, Stefan Greß, Heinz Rothgang und Jürgen Wasem. Einfluss nehmen oder aussteigen: Theorie und Praxis von Kassenwechsel und Selbstverwaltung in der Gesetzlichen Krankenversicherung. Berlin 2008.
- Braun, Bernard, Hartmut Reiners, Melanie Rosenwirth und Sophia Schlette. Anreize zur Verhaltenssteuerung im Gesundheitswesen. Effekte bei Versicherten und Leistungsanbietern. Gütersloh 2006.
- Bundesministerium der Finanzen. »Zur Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung. Ein Kompromissmodell«. Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen. Berlin 2005.
- Bundesrat. »Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKVWSG).« Drucksache 755/06 (Beschluss). www.bundesrat.de/cln_ 099/SharedDocs/Drucksachen/2006/0701 – 800/755 – 06_28B_ 29,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/755 – 06(B).pdf vom 15.12.2006 (Download 22.6.2008).
- »Bürger trauen Fonds nicht«. Ärzte Zeitung 27.5.2008. Busse, Reinhard, und Annette Riesberg. Gesundheitssysteme im Wandel: Deutschland. Kopenhagen 2005.
- CDU. »Deutschland fair ändern«. Beschluss des 17. Parteitages der CDU Deutschlands. Berlin 2003a. CDU. »Bericht der Kommission ›Soziale Sicherheit‹«. 2003b. www.bdi-initiativ-vitalegesellschaft.de/Bericht_Herzog-Kommis sion.PDF (Download 20.8.2007).
- CDU und CSU. »Deutschlands Chancen nutzen«. Regierungsprogramm 2005 – 2009. 2005. www.regierungsprogramm.cdu.de/ download/regierungsprogramm-05 – 09-cducsu.pdf (Download 20.8.2007).
- CDU, CSU und SPD. »Gemeinsam für Deutschland«. Koalitionsvertrag vom 11. November 2005. koalitionsvertrag.spd.de/serv let/PB/show/1645854/111105_Koalitionsvertrag.pdf (Download 20.8.2007).
- CDU, CSU und SPD. »Eckpunkte zu einer Gesundheitsreform 2006«. www.aok-bv.de/imperia/md/content/aokbundesverband/ dokumente/pdf/politik/eckpunkte_040706.pdf (Download 20.8.2007).
- Continentale-Krankenversicherung. Gesundheitsreform – die Meinung der Bevölkerung. Eine repräsentative Infratest-Bevölkerungsbefragung der Continentale Krankenversicherung a. G. Dortmund 2006. www.continentale.de/cipp/continentale/lib/all/lob/return_down load,ticket,guest/bid,1852/no_mime_type,0/~/Continentale-Stu die_2006.pdf (Download 17.5.2008). »Der Zeitpunkt fürs Korbmodell war falsch«. Ärzte Zeitung 19.5.2008.
- Deutscher Bundestag. »Wortprotokoll der 34. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit.« Protokoll Nr. 16/34 2006. www.bundestag.de/ ausschuesse/a14/anhoerungen/029 – 034/Protokolle/034.pdf (Download 20.8.2007).
- Deutscher Bundestag. »Unterrichtung durch die Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG)« – Drucksache 16/3950 – Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates. Drucksache 16/4020 vom 11.1.2007. dip.bundestag.de btd/16/040/1604020.pdf (Download 22.6.2008).
- Döhler, Marian, und Philip Manow. Strukturbildung von Politikfeldern. Opladen 1997.
- Ferner, Elke. »Gesundheitsreform 2007«. Dokument 2007.
- www.elke-ferner.de/fileadmin/upload/Dokumente/Gesundheit/ Reform_Folien-28082007.pdf (Download 20.8.2007).
- Gerlinger, Thomas. »Vom korporatistischen zum wettbewerblichen Ordnungsmodell? Über Kontinuität und Wandel politischer Steuerung im Gesundheitswesen«. Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik? Hrsg. Winand Gellner und Markus Schön. Baden-Baden 2002. 123 – 151.
- Gerlinger, Thomas. »Rot-grüne Gesundheitspolitik 1998 – 003«. Aus Politik und Zeitgeschichte 33 – 34 2003. 6 – 13.
- Gerlinger, Thomas. »Health Care Reform in Germany«. German Policy Studies. Im Erscheinen 2008.
- Gerlinger, Thomas, Kai Mosebach und Rolf Schmucker. »Wettbewerbssteuerung in der Gesundheitspolitik. Die Auswirkungen des GKV-WSG auf das Akteurshandeln im Gesundheitswesen«. Diskussionspapier 2007 – 1 des Instituts für Medizinische Soziologie. www.klinik.uni-frankfurt.de/zgw/medsoz/Disk-Pap/Diskussions papier2007 – 1-W.pdf (Download 23.5.2008).
- »Gesundheitsfonds kann so nicht funktionieren«. Die Welt 8.4.2008 (auch online unter money.de.msn.com/versicherungen/ versicherungen_artikel.aspx?cp-documentID=8012060, Download 25.5.2008).
- Hartmann, Anja. »Gesundheitspolitik: Mehr Probleme als Lösungen?« Wege aus der Krise? Die Agenda der zweiten Großen Koalition. Hrsg. Roland Sturm und Heinrich Pehle. Opladen 2006. 59 – 75. Herzog-Kommission. »Bericht der Kommission ›Soziale Sicherheit‹ 2003.« www.bdi-initiativ-vitalegesellschaft.de/Bericht_HerzogKommission.PDF (Download 20.8.2007).
- Immergut, Ellen M. »Institutions, Veto Points, and Policy Results: A Comparative Analysis of Health Care«. Journal of Public Policy (10) 4 1990. 391 – 416.
- »In der Koalition wächst die Furcht vor dem Fonds«. Ärzte Zeitung 2.6.2008.
- Jann, Werner, und Kai Wegrich. »Phasenmodelle und Politikprozesse: Der Policy Cycle«. Lehrbuch der Politikfeldanalyse. Hrsg. Klaus Schubert und Nils C. Bandelow. München 2003. 71 – 104. Jenkins-Smith, Hank C., und Paul A. Sabatier. »The Study of Public Policy Processes«. Policy Change and Learning. An Advocacy Coalition Approach. Boulder 2003. 1 – 9.
- Kingdon, John W. Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York 2002.
- Knieps, Franz. »Hitler, Honecker und die Gesundheitsreform. Zur Entstehungsgeschichte des Wettbewerbsstärkungsgesetzes«. Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen: Theorie und Politik öffentlichen Handelns, insbesondere der Krankenversicherung. Festschrift zum 65. Geburtstag von Eberhard Wille. Hrsg. Ulrich Volker und Walter Ried. Baden-Baden 2007. 871 – 879.
- »Kuriose Gesundheitswelt: Die KVen müssen sich in Baden-Württemberg per Ausschreibung um die hausärztliche Versorgung bewerben«. Ärzte Zeitung 13.12.2007.
- Lehmbruch, Gerhard. Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Regelsysteme und Spannungslagen im Institutionengefüge der Bundesrepublik Deutschland. Opladen 1998.
- Merkel, Angela. »Rede bei der Haushaltsdebatte« 21. Juni 2006. www.bundeskanzlerin.de/nn_5296/Content/DE/Rede/2006/06/ 2006 – 06 – 1-rede-bundeskanzlerin-merkel-bei-der-haushaltsde batte-2006.html (Download 20.8.2007).
- Merkel, Angela, Kurt Beck und Edmund Stoiber. »Gemeinsame Presseerklärung«. 5. Oktober 2006. www.dkgev.de/pdf/1453.pdf (Download 20.8.2007).
- Parlamentarische Linke in der SPD. »Erste Einschätzung für die PL/ DL 21 zu zentralen Punkten der Gesundheitsreform«. 2006. www.forum-dl21.de/fileadmin/user_upload/Verschiedenes/ Gesundheitsreform/TABELLEGESUNDHEITPL-DL21.pdf (Download 20.8.2007).
- Putnam, Robert D. »Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games«. International Organization (42) 3 1988. 427 – 460.
- Richter, Wolfram F. »Gesundheitsprämie oder Bürgerversicherung? Ein Kompromissvorschlag«. Wirtschaftsdienst (85) 11 2005. 693 – 697.
- Rosenbrock, Rolf, und Thomas Gerlinger. Gesundheitspolitik. Eine systematische Einführung. Bern 2006. Rürup-Kommission. »Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. Bericht der Kommission«. 2003. www.gesundheitspolitik.net/01_gesundheitssystem/reformkonzepte/ uebergreifende-reformkonzepte/ruerup-kommission/ Kommissionsbericht_20030828.pdf (Download 20.8.2007).
- Rürup, Bert, und Eberhard Wille. »Finanzielle Effekte des vorgesehenen Gesundheitsfonds auf die Bundesländer«. Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit 2006. www.bmg.bund.de/nn_603200/DE/Home/Neueste-Nachrichten/ gutachten-ruerup-wile,templateId=raw,property=publicationFile. pdf/gutachten-ruerup-wile.pdf (Download 20.8.2007).
- Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. »Koordination und Qualität im Gesundheitswesen«. Jahresgutachten 2005. Bundestagsdrucksache 15/5670. http:// dip.bundestag.de/btd/15/056/1505670.pdf (Download 5.2.2008).
- Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. »Widerstreitende Interessen – ungenutzte Chancen«. Jahresgutachten 2006. www.sachverstaendigenratwirtschaft.de/ download/gutachten/ga06_ges.pdf (Download 20.8.2007).
- Scharpf, Fritz W. Interaktionsformen. Akteurzentrierter Institutionalismus in der Politikforschung. Wiesbaden 2000.
- Schlette, Sophia, Franz Knieps und Volker Amelung (Hrsg.). Versorgungsmanagement für chronisch Kranke. Lösungsansätze aus den USA und aus Deutschland. Bonn 2005.
- Schubert, Kirsten, und Gerd Glaeske. Einfluss des pharmazeutisch-industriellen Komplexes auf die Selbsthilfe. Bremen 2006. www.kkh.de/ fileserver/kkh2006/BROCHURES/Broschuere404.pdf (Download 24.5.2008).
- Seehofer, Horst, Andreas Storm und Annette Widmann-Mauz. »Argumentationspapier zu den Eckpunkten der Konsensverhandlungen zur Gesundheitsreform«. 2003. cdu-rg.de/bund/Gesundheit_24.07.pdf (Download 20.8.2007).
- SPD. »Modell einer solidarischen Bürgerversicherung«. Bericht der Projektgruppe Bürgerversicherung des SPD-Parteivorstandes. grafspd.de/cms/upload/ModelleinersolidarischenBurger versicherungAugust2004.pdf (Download 18.6.2008).
- SPD. »Vertrauen in Deutschland«. Wahlmanifest der SPD vom 4. Juli 2005. kampagne.spd.de/040705_Wahlmanifest.pdf (Download 20.8.2007).
- Spitzenverbände der Krankenkassen. »Gemeinsame Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung« 24. Oktober 2006. Bundestagsdrucksache 16/3100. www.g-k-v.com/gkv/fileadmin/user_upload/Positionen/stellungnahme_20061106.pdf (Download 23.5.2008)
- Stiller, Sabina. Innovative Agents versus Immovable Objects. The Role of Ideational Leadership in German Welfare State Reform. Wageningen 2007.
- Sturm, Roland, und Heinrich Pehle. »Das Bundeskanzleramt als strategische Machtzentrale«. Jenseits des Ressortdenkens – Reformüberlegungen zur Institutionalisierung strategischer Regierungsführung in Deutschland. Hrsg. Bertelsmann Stiftung. Gütersloh 2007. 56 – 106.
- TK-Meinungspuls Gesundheit. Ein Jahr GKV-WSG: Eine Bilanz. Umfrage von Forsa im Auftrag der Techniker Krankenkasse 2008. www.tk-online.de/centaurus/generator/tk-online.de/s03__presse center/08__publikationen/archiv__publikationen/publikationen __im__archiv/forsastudie2008-1-jahr-gesundheitsreform__pdf, property=Data.pdf (Download 16.5.2008).
- Trampusch, Christine. »Von Verbänden zu Parteien: Elitenwechsel in der Sozialpolitik«. Zeitschrift für Parlamentsfragen (35) 4 2004. 646 – 666.
- Velter, Boris M. »Das GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz: Alles nur Murks?« Vortrag an der TU Berlin am 6. Juni 2007. www.bks.tuberlin.de/SS07/velter.pdf (Download 20.8.2007).
- Wasem, Jürgen. »Stellungnahme zum Themenbereich ›Finanzierung‹«. Sachverständigenanhörung zum GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz. 2006 www.bundestag.de/ausschuesse/a14/anhoerungen/029 – 034/stll_eingel/Wasem1.pdf (Download 20.1.2008). Zahariadis, Nikolaos. »The Multiple Streams Framework. Structure, Limitations, Prospects«. Theories of the Policy Process. Hrsg. Paul A. Sabatier. Boulder 2007. 65 – 92.