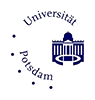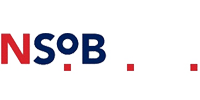Die Politikwissenschaftler Manuel Fröhlich und Stefan Schneider haben eine Fallstudie zur „Großen Steuerreform“ der Regierung Kohl erstellt. Die Reform des Steuersystems gehört zu den politischen Themen, die für die Regierung Kohl vor und während der 13. Wahlperiode fast immer aktuell waren. Über die Grundlinien der Steuerpolitik bestand innerhalb von Union und Koalition Einigkeit (dies war ja u. a. Gegenstand des als „Scheidungspapier“ der sozial-liberalen Koalition apostrophierten Textes von Graf Lambsdorff; Lambsdorff 1982).
1 Einleitung
Die Reform des Steuersystems gehört zu den politischen Themen, die für die Regierung Kohl vor und während der 13. Wahlperiode fast immer aktuell waren. Über die Grundlinien der Steuerpolitik bestand innerhalb von Union und Koalition Einigkeit (dies war ja u. a. Gegenstand des als »Scheidungspapier« der sozial-liberalen Koalition apostrophierten Textes von Graf Lambsdorff; Lambsdorff 1982).
Dennoch erwiesen sich die Widerstände in der eigenen Partei sowie innerhalb der Koalition und nicht zuletzt die von der Opposition und einzelnen Landesregierungen im Bundesrat errichteten Hürden als zu hoch, als dass es der Bundesregierung gelingen konnte, eine grundlegende Reform des Fiskalsystems umzusetzen. Insofern eignet sich die Analyse des Versuchs zur Steuerreform 1998 als Beispiel für die Komplexität und die Schwierigkeiten, mit denen Reformpolitik in Deutschland behaftet ist.
Tatsächlich wurden die offenkundigen Probleme beim Versuch der Steuerreform sowohl in der praktischen Politik (etwa in der Ruck-Rede Roman Herzogs) als auch in der Politikwissenschaft (etwa in Gerhard Lehmbruchs Studie zum Parteienwettbewerb im Bundesstaat) zum Anlass für eine grundsätzliche Debatte über die politische Handlungsfähigkeit in der Bundesrepublik genommen (Herzog 1997; Lehmbruch 2002). Diese symptomatische Verdichtung macht das Beispiel der Steuerreform zugleich zu einem aussagefähigen Anwendungsfall für das Strategietool für politische Reformprozesse (SPR) der Bertelsmann Stiftung, obwohl es gerade nicht zu einer Umsetzung der Reform kam. Die hier verfolgte Anwendung des SPR auf ein historisch abgeschlossenes Beispiel wird vor diesem Hintergrund die Relevanz der Kriterien und Kategorien des SPR oftmals im Sinne einer Defizitanalyse sozusagen »ex negativo« herausarbeiten.
Dabei fällt es schwer, den Reformzyklus »Große Steuerreform« ab Mitte der 90er Jahre von vorangegangenen Bemühungen in diesem Politikfeld abzugrenzen. Der Beginn des Untersuchungszeitraumes im weiteren Sinn muss infolgedessen auf den Beginn der 13. Wahlperiode gelegt werden. Im engeren Sinn beginnt er mit der Debatte um das Jahressteuergesetz 1996 im Herbst 1995, als erste offizielle Delegationsgespräche zwischen Koalition und SPD über eine gemeinsame Steuerpolitik stattfanden.
Obwohl das Misslingen der »Großen Steuerreform« Helmut Kohls unzählige Male ausgerufen wurde (vgl. etwa Die Welt 27.3.1997, WAZ 10.7.1997, FAZ 30.7.1997, Waigel im DLF 30.7.1997 sowie Schäuble in Bild 1.8.1997 und Berliner Zeitung 11.9.1997), ist das endgültige Scheitern dieses Reformanlaufs auf den 10. Dezember 1997 zu datieren. Trotz der teilweisen Annäherung, die Union und SPD in dieser letzten Verhandlungsrunde bei den beiden kritischen Fragen Spitzen- und Eingangssteuersatz mittels leichter Anhebung von Mehrwert- und Mineralölsteuer erzielen konnten, war die FDP nicht dazu bereit, Steuererhöhungen mitzutragen (SZ 12.12.97; Schäuble 1998: 7).
Der Weg hin zu diesem Ende des Versuchs war durch eine Reihe von Initiativen und Ereignissen geprägt: von den beiden Reformkommissionen unter der Leitung von Wolfgang Schäuble und Theo Waigel, den Petersberger Steuervorschlägen der Kommission Waigels, den Spitzengesprächen zwischen Helmut Kohl und Oskar Lafontaine, der Senkung der Kohlesubvention mit den daraus resultierenden Protesten der Bergleute in Bonn sowie nicht zuletzt durch das Scheitern zweier Vermittlungsverfahren.
Die nachfolgende Analyse baut auf einer detaillierten Rekonstruktion der Ereignisse bzw. der Geschichte der Steuerreform auf. Der dabei gewählte Weg schließt methodisch an das Verfahren des Process-Tracing an (vgl. George und Bennett 2005) und setzt zunächst ein »detailed narrative« (George und Bennett 2005: 210) voraus, das möglichst genau Verlauf und Ereignisse der Politikentwicklung darstellt. Ausgehend vom »detailed narrative«, das an dieser Stelle nicht umfassend wiedergegeben werden kann, dient die Bezugnahme auf das SPR zur Schilderung einer »analytic explanation« (George und Bennett 2005: 211), also dem Versuch, die chronologische Darstellung durch strukturierte und gewichtete Fokussierung in einen Erklärungszusammenhang für die Politikentwicklung zu übersetzen.
Wichtig für die Analyse wird dabei auch sein, dass das ProcessTracing gerade nicht von monokausalen Erklärungen für politische Prozesse ausgeht, sondern das Zusammenwirken, die Interaktion und Transformation unterschiedlicher Bestimmungsfaktoren im Laufe der Zeit in den Blick bekommen will (vgl. George und Bennett 2005: 212).
Die Rekonstruktion des Versuchs zur Steuerreform stützt sich wesentlich auf die Medienberichterstattung. Deren intensive Auswertung erfolgte dabei nicht als Ermittlung eines Medien-Tenors, sondern vielmehr zur möglichst genauen Nachverfolgung der Positionen, Ereignisse und Entscheidungsabläufe. Eine Auswertung von etwa nur drei oder vier großen Tageszeitungen würde für diese Zwecke zu kurz greifen. Deshalb wurde die Anzahl und Breite der Quellen unter Nutzung der Bestände des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung erhöht bzw. erweitert und schließt insbesondere auch die Verschriftlichung von Beiträgen aus Rundfunk und Fernsehen ein, die gerade für den vom SPR als konstitutiv angesehenen Bereich der Kommunikation von Bedeutung sind (dabei konnte auf die umfangreichen Ressourcen des »Referats 206 Zentrales Dokumentationssystem« des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung zurückgegriffen werden).
Die solchermaßen angelegte Rekonstruktion des Zeitraums September 1995 bis Dezember 1997 liefert das Gerüst der Untersuchung. Zusätzlich wurden Protokolle von Parlamentsdebatten und Parteitagen, öffentliche Reden und Erklärungen des Bundeskanzlers und seiner Minister sowie die Berichte der Expertenkommissionen als Quellen herangezogen. In diesem Kontext ist auch auf eine Reihe von Aussagen aus Schilderungen von Beteiligten zu verweisen, wie sie sich etwa in Helmut Kohls Tagebuch (Kohl 2000), Wolfgang Schäubles Schilderung (Schäuble 2000) oder Theodor Waigels Darstellung zum Werdegang der Petersberger Steuervorschläge (Waigel 1999) finden lassen.
Die wissenschaftliche Literatur zum Thema besteht hauptsächlich aus Aufsätzen und weniger aus Monographien. Einen grundlegenden Beitrag zum Thema hat Steffen Ganghof mit seinem Buch »Wer regiert in der Steuerpolitik?« geliefert (Ganghof 2004). Ganghof setzt sich detailliert mit den Steuerreform(versuch)en in der Bundesrepublik Deutschland seit 1977 auseinander und ordnet sie in den internationalen Kontext ein.
Timo Grunden befasst sich in seiner Untersuchung zur Frage der sozialen Gleichheit in der Steuer- und Haushaltspolitik mit dem Thema der Steuerreform der Regierung Kohl Ende der 90er Jahre (Grunden 2004). Für den vorliegenden Text ist dabei insbesondere die Einordnung des Reformversuchs in die längerfristige Steuer- und Haushaltspolitik Kohls von Interesse.
Die Studie von Hendrik Träger (2008) liefert dagegen eine detailreiche Schilderung der Rolle und Position der SPD beim Versuch zur Steuerreform – eine Perspektive, die aufgrund der oftmals zitierten Blockadepolitik der Opposition durchaus als wesentlich für die Politikentwicklung gelten kann. Mit Blick auf die Ursachen des Scheiterns findet sich eine aufschlussreiche und analytisch reflektierte Kontroverse in der Debatte zwischen Reimut Zohlnhöfer (Zohlnhöfer 1999) und Wolfgang Renzsch (Renzsch 2000), die in der Zeitschrift für Parlamentsfragen dokumentiert ist.
2 Strategiefähige Kernexekutive: Akteure der Steuerreformpolitik
Steuerreformen gehören zu den wenigen dem Staat verbliebenen Instrumenten, die es ihm erlauben, sich im Wettbewerb mit seinen Konkurrenten Standortvorteile zu verschaffen (vgl. Sturm 1998; Zohlnhöfer 2006; zur Finanzpolitik Kohls auch: Gros 1998). Während die Auf- oder Abwertung der eigenen oder fremder Währungen zu den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Instrumenten der Finanz- und Wirtschaftspolitik zählen, gelten Reformen des Fiskalsystems als längerfristig funktionierende Werkzeuge.
Mit jeder Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist dieses Werkzeug für den Nationalstaat Deutschland jedoch stumpfer geworden. Durch die Verpflichtungen im Europäischen Währungssystem ging seit Anfang der 70er Jahre – neben den zahlreichen Vorteilen einer im Werden begriffenen stabilen europäischen Währung – ein Verlust an Steuerungsmöglichkeiten unter anderem des eigenen Außenhandels mittels der Bewertung der Deutschen Mark einher.
Umgekehrt gewann das System der Erhebung von Steuern für die Lenkungskraft des Staates damit an Bedeutung, da dieses weiterhin im Kompetenzbereich des Nationalstaates verblieb (Wagschal 1998: 5). Insofern ist die Steuerpolitik im Wortsinne auch eine herausgehobene Möglichkeit der Regierung, zu »steuern«.
Aufgrund ihrer für die betroffenen Bürger unmittelbar erkennbaren Konsequenzen sowie ihrer Interdependenz zur allgemeinen Wirtschaftslage einerseits und der Haushaltssituation andererseits handelt es sich um einen wichtigen Bereich der Regierungspolitik, der in der Regel in enger Abstimmung zwischen dem Kanzleramt und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gestaltet wird.
Wegen der grundsätzlichen Steuerungswirkung und der symbolischen Relevanz für die Wirtschaftspolitik sind jedoch auch die Akteure aus Partei und Fraktion regelmäßig involviert.
Eine Schlüsselstellung für die Steuerreform 1998 hatte zweifellos Finanzminister Theo Waigel inne. Als Chef des BMF verfügte er nicht nur über wichtige fachliche Ressourcen, sondern auch über das entsprechende Zahlenmaterial, das für die Schätzung von zu erwartenden Einnahmen und Verlusten notwendig ist. Neben seiner Funktion als Finanzminister war Waigel zudem seit 1988 Parteivorsitzender der CSU. Aufgrund dieser Konstellation ist der Einfluss Waigels im Kabinett Kohl kaum zu überschätzen.
Die Doppelfunktion als Repräsentant der kleineren Unionsschwester und Bundesminister hatte für die Reformpolitik sowohl positive als auch negative Auswirkungen, da etwa die Konkurrenz Waigels mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber durchaus in konkreten Fragen der Politikgestaltung zum Problem wurde. So mahnte Stoiber beispielsweise den ohnehin bei der Steuerpolitik in Bedrängnis geratenen Finanzminister zur strikten Einhaltung der Maastricht-Kriterien.
Zu den relevanten Entscheidern im engeren Kreis ist zudem Wolfgang Schäuble zu zählen. Als Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag und intellektueller Kopf hinter der Steuerreform begleitete er das Vorhaben von Anfang bis Ende. So war er nicht nur in der Reformkommission Waigels vertreten, sondern setzte sich im Juni 1996 zudem als Chef der 24-köpfigen CDU-Steuerkommission »Zukunft des Steuersystems« gegen den ausgewiesenen Steuerfachmann Friedrich Merz durch. Bei den Steuergipfeln mit der SPD war Schäuble Mitglied der Verhandlungsdelegation und nahm auch in der Kommunikation, in der Öffentlichkeit sowie in der parteipolitischen Arena eine bedeutende Position ein.
Eine wichtige Rolle spielte in diesem Sinn auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Hermann Otto Solms. Solms war zugleich Schatzmeister seiner Partei und nahm ebenfalls regelmäßig an den Steuerverhandlungen zwischen Koalition und SPD teil. Der Einfluss des kleinen Koalitionspartners FDP darf nicht unterschätzt werden, da es nicht zuletzt Solms war, der in den letzten Verhandlungen der Koalition mit der SPD im Dezember 1997 eine mögliche Einigung zwischen Sozial- und Christdemokraten bei der Ausgestaltung von Spitzen- und Eingangssteuersatz sowie der Mehrwert- und Mineralölsteuer blockierte und ostentativ am Image der FDP als Steuersenkungspartei festhielt.
Dem Bundeskanzler und dem Kanzleramt kommt in der Kernexekutive naturgemäß eine zentrale Rolle zu (vgl. Korte und Fröhlich 2006: 81 – 91; Knoll 2004; Mertes 2003; zu Kohl speziell Korte 1998). Vor dem Hintergrund der teils divergierenden Interessen in Parlament, Ministerialbürokratie und Partei lässt sich die Rolle des Kanzleramtes annäherungsweise durch Worte wie »führen, koordinieren, Strippen ziehen« (Mertes 2000) beschreiben.
Bundeskanzler Helmut Kohl zeigte phasenweise auffällig wenig Präsenz in der Reformdiskussion – unter anderem, um eine vorschnelle Festlegung oder Exponierung zu vermeiden. Tatsächlich hat er nicht zuletzt aufgrund des guten Verhältnisses zu Waigel die Steuerreform weitgehend in den Händen des zuständigen Ministeriums belassen.
Dies heißt natürlich nicht, dass die entsprechenden Einheiten des Kanzleramtes nicht auch die Steuerreform begleitet hätten: Der Arbeitsstab »Öffentlichkeitsarbeit und Medienpolitik« unter Andreas Fritzenkötter, die Abteilung 4 »Wirtschafts- und Finanzpolitik; Koordinierung neue Länder« unter Sieghart Nehring sowie nicht zuletzt die Abteilung 5 »Gesellschaftliche und politische Analysen; kulturelle Angelegenheiten« unter Michael Mertes haben jeweils die Reformdebatte verfolgt – allerdings in der vorliegenden Konstellation nicht in Konkurrenz zum Finanzministerium und auch nicht fokussiert auf sachpolitische Details der Reform, sondern mit Blick auf die machtpolitischen Implikationen des Projekts, die im Abschnitt »Erfolgskontrolle« näher betrachtet werden. Anstelle von Kohl hat sich häufiger auch Friedrich Bohl als Chef des Bundeskanzleramtes in die öffentliche Diskussion eingeschaltet.
Kohl hatte die Steuerpolitik weder im Regierungsprogramm noch in der ersten Hälfte der Legislaturperiode zur Chefsache erklärt. Die Phase der Zurückhaltung endete erst im Frühjahr 1996, als die FDP einen »Tempokonflikt mit einem Beruhigungskanzler« (Focus 25.3.1996) prognostiziert hatte und Kohl bemerkte, wie schnell sich die Anhänger eines neuen Steuerrechts auch in der eigenen Fraktion gemehrt hatten (Der Spiegel 22.4.1996). Dazu kam eine erkennbare Neuorientierung der Regierungspolitik nach dem Scheitern des Bündnisses für Arbeit. Später zwang die SPD Kohl dazu, eine sichtbare Rolle zu übernehmen und direkt mit Oskar Lafontaine zu verhandeln.
Gegenspieler auf allen Ebenen war die SPD. Ihre Vetoposition, über die sie mittels ihrer Mehrheit im Bundesrat verfügte, reizte sie maximal aus (Träger 2008). Allen voran gelang es dem SPD-Bundesvorsitzenden Oskar Lafontaine, die Koalitionsparteien aufgrund ihrer teilweise unterschiedlichen Lösungsansätze geschickt gegeneinander auszuspielen. Gemeinsam mit dem Finanzminister des SPD-geführten Landes Nordrhein-Westfalen, Heinz Schleußer, und dem Finanzexperten der SPD-Bundestagsfraktion, Joachim Poß, stellte er die Zahlengrundlage des Bundesfinanzministeriums wiederholt in Frage, indem er einen Abgleich der Beträge diverser Reformvorschläge der Koalition mit dem Finanzministerium in Düsseldorf forderte. Überhaupt war das nordrhein-westfälische Finanzministerium Dreh- und Angelpunkt der sozialdemokratischen Expertise in Sachen Steuerreform. Entwürfe des politischen Konkurrenten und eigene Konzepte wurden hier geprüft und durchgerechnet.
Der SPD-dominierte Bundesrat spielte eine ebenso entscheidende wie ambivalente Rolle: Der Erfolg von Zustimmungsgesetzen hing vom Einverständnis der Sozialdemokraten ab. Die Taktik von Seiten der Koalition, einzelne reformwillige SPD-Ministerpräsidenten aus der Front im Bundesrat herauszulösen, war dabei nicht von Erfolg gekrönt. Die Kluft verlief jedoch nicht nur zwischen Regierung und Opposition im Bund, sondern auch zwischen Ost- und Westländern.
Der Grund dafür war der Solidarzuschlag, dessen Abschaffung mehrfach im Gespräch war. Hier war es Thüringens christdemokratischer Ministerpräsident Bernhard Vogel, dem bescheinigt wurde, eine Front gegen die Abschaffung des Soli organisiert (Die Welt 29.5.1997) zu haben. Obwohl einzelne Finanzminister aus den Ländern in den Reformprozess einbezogen wurden, etwa Georg Milbradt aus Sachsen oder der Bayer Erwin Huber, kann von einer intensiven Zusammenarbeit mit den B-Ländern nicht gesprochen werden.
Zwei weiteren Akteuren kam zu Beginn der Reform eine wichtige Rolle zu, ohne dass sie diese im Verlauf des Vorhabens hätten fortsetzen können: Gunnar Uldall und Peter Bareis. Während Bareis mit den Vorschlägen der nach ihm benannten Kommission bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt ein balanciertes Konzept vorlegt hatte, das von Waigel aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt und vertagt wurde, ist Uldall als eine der Triebfedern der Reform anzusehen. Unbeirrt hat er gegen allen Widerstand von Kohl und Waigel für sein Konzept eines dreistufigen Steuersatzes geworben und damit dafür gesorgt, dass die Reform überhaupt in Angriff genommen wurde. Dies führt zur Frage, wie neue Ideen in die Regierungspolitik Eingang fanden.
2.1 Kompetenz: Expertenkommissionen als Ideenentwickler
Mit der allgemeinen Vorgabe aus der Regierungserklärung vom November 1994 zur Vereinfachung des Steuerrechts war die Notwendigkeit bestärkt worden, nach neuen Möglichkeiten und Ideen im Bereich des Fiskalsystems zu suchen. Das Thema wurde jedoch nicht prioritär verfolgt und es dauerte über ein Jahr, bis der Diskurs greifbare Ergebnisse zeitigte.
Bereits 1993 hatte das Bundesministerium der Finanzen eine Kommission unter Bareis mit der Erarbeitung von Vorschlägen für eine Reform der Einkommensteuer beauftragt und auf diese Weise externe Expertise eingebunden. Um der Forderung des Bundesverfassungsgerichts nach der Freistellung eines Existenzminimums zu entsprechen, schlug die Kommission die Erhöhung des Grundfreibetrags vor. Durch die Anhebung des Eingangssteuersatzes von 19 auf 22 Prozent sollte ein Teil der Einnahmeausfälle refinanziert werden, ein etwas größerer Teil sollte als Nettoentlastung verbleiben. Für die Refinanzierung der restlichen Ausfälle regte die Expertengruppe die Verbreiterung und Systematisierung der Einkommensbesteuerung an (Einkommensteuerkommission 1995).
In der Summe ergab sich folglich eine durchaus problematische Kombination von steigenden Steuersätzen und unpopulären Einschnitten bei den Steuervergünstigungen: »Aufgrund der relativ geringen Nettoentlastung hätte es gut abgegrenzte Gruppen von Reformverlierern gegeben, und die dadurch vorhersehbaren Aufschreie der Betroffenen hätten nicht durch Verweise auf niedrige Steuersätze für alle gekontert werden können« (Ganghof 2004: 87). Es verwundert also nicht, dass Bundesfinanzminister Theo Waigel die Empfehlungen der Bareis-Kommission ablehnte und ihnen keine weitere Beachtung schenkte, weil er sie für politisch nicht durchsetzbar hielt (Homeyer 1996: 519).
Die Kommission wurde noch nicht einmal im Finanzausschuss des Bundestages angehört. Wirkungslos waren die Vorschläge der Bareis-Kommission dennoch nicht, denn sie stießen eine grundsätzliche Diskussion um die Reform der Einkommensteuer an.
Bis Ende des Jahres 1995 waren weder die Parteien noch die Bundesregierung mit konkreten Plänen zur Reform des Steuersystems an die Öffentlichkeit getreten. Eine erkennbare Ausnahme stellt Gunnar Uldall dar, Mitglied von CDU und Bundestag, der bereits seit Mitte 1994 für ein Reformkonzept einer Einkommensteuerreform mit Stufensätzen von 8, 18 und 28 Prozent bei gleichzeitiger Streichung fast aller Steuerprivilegien und -ausnahmetatbestände geworben hatte, ohne dabei die Unterstützung seiner Partei zu gewinnen (Uldall 1996).
Waigel erteilte auch diesen Plänen eine Absage und hielt sie allenfalls als langfristiges Ziel für denkbar, für das gewaltig viel Überzeugungsarbeit geleistet werden müsse (FAS 4.2.1996). Zwar beschäftige sich das Bundesministerium der Finanzen – mittels der Nutzung interner Expertise – mit der Planung einer umfassenden Reform des Steuersystems, diese sei jedoch für den Zeitraum 1998 bis 2000, also nach der Bundestagswahl, geplant (FAS 4.2.1996).
Im Frühjahr 1996 mehrte sich die Schar derer in den Reihen der Union, die sich für Uldalls Steuerkonzept erwärmen konnten. Das Steuerthema wurde in einer Debatte des Bundestages aufgegriffen und lebhaft diskutiert (BT Sten. Ber. 13/89). Kohl, der bemerkt hatte, wie viele Anhänger Uldall um sich sammeln konnte, schwenkte nach Beratungen der Koalition im Bundeskanzleramt Mitte April um: Die Reform der Einkommensteuer solle nun doch auf die aktuelle Legislaturperiode vorgezogen werden (Handelsblatt 15.4.1996).
Gegen dieses beschleunigte Verfahren machte Finanzminister Waigel allerdings Bedenken geltend: Zuvor müssten Vermögens-, Erbschafts-, Kfz- und Unternehmenssteuer reformiert werden (Die Welt 17.4.1996). Ungeachtet dieser Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Bundesregierung im Hinblick auf das weitere Vorgehen blieb Helmut Kohl jedoch bei dem von ihm eingeschlagenen Weg und erklärte, der Gesetzgebungsprozess solle Ende 1997 abgeschlossen werden und der neue Steuertarif dann zum 1. Januar 1999 in Kraft treten (BT Sten. Ber. 13/102 26.4.1996). Dazu werde die Bundesregierung in Kürze eine Kommission unter dem Vorsitz des Bundesfinanzministers einsetzen, die ihre Vorschläge bis Ende 1996 vorlegen solle (BT Sten. Ber. 13/102: 8982).
Diese Initiative Kohls kann durchaus der SPR-Anforderung »personelle Kompetenzen und Leadership ausbauen« zugeordnet werden, da Kohl sich einerseits direkt in den Entscheidungsablauf einschaltete und andererseits über die Einsetzung der Kommission eine inhaltliche und personelle Fokussierung der Debatte anvisierte. Mittlerweile hatte sich allerdings auch die SPD in ihrem Programm »Zukunft sichern – Zusammenhalt stärken« (SPD 1996) positioniert; Übereinstimmungen waren kaum erkennbar.
Um dem ehrgeizigen Ziel, Ende 1996 ein beschlussfähiges Konzept vorliegen zu haben, näher zu kommen, setzte CDU-Generalsekretär Peter Hintze mit Blick auf den Hannoveraner Parteitag im Mai 1996 eine »Parteikommission Steuern« ein. Anstelle des zunächst vorgesehenen Friedrich Merz wurde Wolfgang Schäuble mit der Kommissionsleitung beauftragt, was ihr zusätzliches Gewicht verlieh (Bremer Nachrichten 11.6.1996) und Schäuble als wichtigen Akteur neben Waigel etablierte.
Waigel, der diesen Schritt als Erhöhung des Drucks auf seine Person begriff – gab es doch bereits eine Steuerkommission, an der zahlreiche CDU-Vertreter beteiligt waren –, bemühte sich, den Impuls zur Beschleunigung des Verfahrens wiederum zu entschleunigen und die Erwartungen an die geplante Steuerreform zu senken. Er bezweifelte, dass es bis 1998 gelingen werde, die Streichung wichtiger Subventionen mit allen Interessenverbänden zu verhandeln (Die Welt 3.5.1996). Das Politikfeld war jedoch erkennbar dynamisiert worden: Mit der Kommission des BMF und den Kommissionen von CDU, CSU, SPD, FDP sowie Bündnis 90/Die Grünen arbeiteten im Sommer 1996 nicht weniger als sechs Gremien an Reformkonzepten. Äußerst medienwirksam hatten auch die Delegierten auf dem Bundesparteitag der FDP (Karlsruhe, 7. bis 9.7.1996) einen an die Vorschläge Uldalls angelehnten Drei-Stufen-Tarif von 15, 25 und 35 Prozent für die Einkommensbesteuerung beschlossen.
Wenngleich interne (und weniger externe) Expertise also von verschiedenen Seiten genutzt wurde, war (bis auf einige Gemeinsamkeiten wie die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage durch Abbau von Steuervergünstigungen und Senkung der Steuersätze sowie die Verstärkung der steuerlichen Missbrauchsbekämpfung und die Erleichterung des betrieblichen Generationenwechsels) kaum eine einheitliche Linie aus den verschiedenen Vorschlägen zu destillieren. Dies machte zugleich die Reformkommunikation schwierig.
2.2 Kommunikation: Regierungskommunikation im Zeichen von Interessenpluralität
Die Regierungszentrale verfügte durchaus über eine mehrjährig bewährte Infrastruktur für eine kohärente politische Kommunikation (Fröhlich 1997; Korte 1998). Im Zentrum stand dabei die so genannte Morgenlage, bei der Kohl in der Regel mit dem Chef des Bundeskanzleramtes, allen Staatsministern des Amtes, den Abteilungsleitern 2 »Außenpolitik« und 5 »Politische Analyse«, seiner persönlichen Referentin sowie dem Chef des Presse- und Informationsamtes zusammenkam (Korte 2003: 35; Rosumek 2007: 157 – 220).
Seit 1995 gehörte diesem Kreis auch Andreas Fritzenkötter als Leiter des neu geschaffenen Arbeitsstabes »Öffentlichkeitsarbeit und Medienpolitik« an. Seine Berufung zum persönlichen Sprecher Kohls (Mertes 2000: 70) war durchaus nicht unproblematisch, da sie eine enge und gleichgerichtete Zusammenarbeit mit dem Regierungssprecher voraussetzte, um Kohärenz herzustellen (siehe auch das Interview mit Fritzenkötter in Rosumek 2007: 203 – 220).
Die Berufung Fritzenkötters kann – wenn auch nicht gesondert auf die Steuerreform bezogen – dennoch als institutionelle Anpassung im Kommunikationsbereich gelten, da zumindest er selbst durch diese Entscheidung und seine Ernennung auch eine gewisse Modernisierung und Öffnung der Kommunikationsstrukturen im Kanzleramt etabliert sieht. Seine Rolle sieht er jedoch bewusst hinter den Kulissen (zitiert in Rosumek 2007: 204) und auch nicht in Konkurrenz zum Regierungssprecher, der für die gesamte Koalition sprechen müsse. Die Morgenlage ist vor diesem Hintergrund als Runde persönlicher Vertrauter zu verstehen; hier wurden Termine und Verlautbarungen sowie die Kommunikationsbemühungen abgestimmt.
Die von Beginn an erkennbaren Unterschiede zwischen den Koalitionspartnern erschwerten jedoch eine Abstimmung der Kommunikation. Dies alleine ist nicht weiter außergewöhnlich (Mertes 2007: 31), wurde jedoch durch eine Reihe von Faktoren so beeinflusst, dass es zu einer eher reaktiven als aktiven Kommunikation kam: Zum einen war dies dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Juni 1995 geschuldet, in dem das Gericht den Gesetzgeber zu einer Neuregelung der Bemessungsgrundlage der Vermögenssteuer bis Ende des Jahres 1996 aufforderte (BVerfGE 93: 122).
Zum anderen gaben die Beratungen über das Jahressteuergesetz 1996 Anlass dafür, dass eine Vereinfachung der Lohn- und Einkommensteuer verstärkt diskutiert wurde. Dabei war jedoch sichtbar geworden, dass im Haushalt von Bund, Ländern und Gemeinden ein Loch von 56 Milliarden D-Mark klaffte. Gleichzeitig hatte die Zahl der Arbeitslosen die Grenze von vier Millionen überschritten und die Steuerzahler beklagten die nach wie vor hohe Abgabenlast. Die Vielstimmigkeit in der politischen Debatte und die über diverse Kommissionen gegebene Vervielfältigung von Gremien mit eigenem Kommunikationsanspruch erschwerten die Situation zusätzlich. Der Versuch des Relaunches einer einheitlichen Strategie für die Regierungsarbeit mit dem im Frühjahr beschlossenen »Programm für Wachstum und Beschäftigung« konnte nicht durchdringen, da das Programm zuvörderst als Sparpaket wahrgenommen wurde – ein Eindruck, der durch die rasche Umsetzung einiger seiner Teile (gegen den erwartbaren Widerstand der Gewerkschaften und der SPD; FAZ 15.5.1996) noch verstärkt wurde und sich kommunikativ dem Vorwurf öffnete, einseitig arbeitgeberfreudige Politik zu verfolgen: Die geplante Erhöhung des Kindergeldes – eine Hauptforderung der SPD-Opposition – wurde vertagt, während die Vermögenssteuer zum 1. Januar 1997 abgeschafft wurde (Die Welt 23.5.1996). Gleichwohl musste der Regierung klar gewesen sein, dass sie zur Durchsetzung weitergehender Maßnahmen auch über ein Konzept der Umsetzung verfügen musste, das mit der potenziellen Blockademacht der SPD im Bundesrat umgehen konnte.
2.3 Durchsetzungsfähigkeit: Vernetzung ohne gesonderte Etablierung eines strategischen Machtzentrums
Nachdem Kohl über den Kabinettsbeschluss innerhalb der Koalition und der Regierung eine Position markiert hatte und durch die Einsetzung der Kommissionen wichtige Akteure benannt und ressortübergreifend vernetzt hatte, wandte er sich dem Problem erwartbarer Widerstände im Bundesrat zu – ein Vorgehen, das durchaus im Sinne der SPR-Anforderung »Konfliktfrühwarnsystem aufbauen« verstanden werden kann, wenngleich es nicht zu einer wie auch immer gearteten institutionellen Verdichtung dieser Bemühungen kam. Hier schaltete sich der Kanzler vielmehr selbst ein und verhandelte (einem etablierten Muster zur Umgehung von Blockaden im Bundesrat folgend) direkt mit den Ministerpräsidenten über potenzielle Konzessionen und Kompromisse. Diese Konstellation schloss den Finanzminister aus, sodass Renzsch hier sogar den Anlass zu einer Distanzierung zwischen Kohl und Waigel erkennt (Renzsch 2000: 189).
Die SPD-geführten Länder hatten anlässlich des Entwurfs eines Jahressteuergesetzes 1997 (BR-Drs. 390/96) deutlich gemacht, dass sie die ersatzlose Streichung der Vermögenssteuer ebenso ablehnten wie die großzügige Reform der Erbschaftssteuer. Für ihre Zustimmung im Bundesrat hatten sie finanziellen Ersatz gefordert (SZ 1.6.1996). Unter der Zusage, dass der Bund keine Kosten auf die Länder abwälzen werde, konnte Kohl größeres Wohlwollen der Länderchefs für eine gemeinsame Zusammenarbeit bei einem nationalen Sparpaket verzeichnen (SZ 14.6.1996). Die konkrete Aufteilung der Finanzlasten oder gar Kompensationsgeschäfte bzw. Anreize zur Unterstützung wurden jedoch nicht erkennbar.
Grundsätzlich lähmte das vorsichtige Navigieren zur Beibehaltung eines möglichst großen Handlungsspielraums die Herausbildung klarer Positionen und Zuständigkeiten in der Kernexekutive. Interministerielle Kooperation oder der Austausch zwischen verschiedenen Planungseinheiten war zwar ansatzweise in den diversen Kommissionen gegeben – dies jedoch mehr als Resultante jeweiliger parteipolitischer Überlegungen denn als Ausdruck strategischer Planung der Kernexekutive.
Eine umfassende ressortübergreifende Vernetzung der Akteure sowie der Aufbau eines themenspezifischen Frühwarnsystems im strategischen Machtzentrum kann am Beispiel des Steuerreformversuches nur ansatzweise erkannt werden. Reaktion statt Aktion, Überraschung statt Kalkül und taktische Positionsverschiebungen statt strategischer Linie bestimmen den Eindruck.
Eine besondere Schwierigkeit der politischen Kommunikation mit Auswirkungen auf die Etablierung des strategischen Machtzentrums bestand darin, dass – aus vielfältigen Gründen – in der politischen Debatte das Verhalten des Kanzlers in der Steuerreform als Ausweis bzw. Ausfall seiner politischen Führungsqualität und Zukunftsfähigkeit (auch und gerade aus der eigenen Partei heraus) gedeutet wurde.
Wenn Personalisierung der politischen Kommunikation unbestritten helfen kann, so kann sie in solchen Fällen zugleich zur Bürde werden, weil der machtpolitische Unterton einer Debatte deren sachpolitischen Gehalt in den Schatten stellt. Da ohne erkennbares Ziel auch die Ausbildung einer Strategie und damit eines strategiefähigen Machtzentrums abseits der bereits beschriebenen Zuständigkeiten und Akteurskonstellationen schwierig wird (Raschke und Tils 2007: 128; Glaab 2007), wurde hier eine Hypothek in die weitere Gestaltung des Reformprozesses übertragen.
3 Agenda-Setting: unfreiwilliger Reformanlauf unter ungünstigen Bedingungen
Zur Charakterisierung der strategiefähigen Kernexekutive wurde bereits auf mehrere Initiativen, Kommissionen und Diskussionen hingewiesen, die die inhaltliche Debatte um die Steuerreform prägten. Hier soll nun wiederum aus der Perspektive der Kernexekutive ein näherer Blick auf das Agenda-Setting im Reformprozess geworfen werden. Dazu sind einige allgemeine Kontextinformationen notwendig.
Die Regierung von Helmut Kohl wurde im Oktober 1994 nur sehr knapp im Amt bestätigt. Besonders die FDP erfuhr eine empfindliche Schwächung, denn sie erreichte auf Bundesebene nur noch 6,9 Prozent gegenüber elf Prozent im Jahr 1990. In einige ostdeutsche Landtage konnte sie zudem nicht mehr einziehen. Gestärkt ging hingegen die SPD aus den Bundestagswahlen hervor, die überdies im Bundesrat bereits seit dem Amtsantritt der rot-grünen Regierung in Hessen unter Hans Eichel im April 1991 über die absolute Mehrheit der Stimmen verfügte. Seit der Ablösung der schwarz-gelben Regierung in Magdeburg durch Reinhard Höppner im Juli 1994 konnte die SPD gar über mehr als drei Viertel der Bundesratsstimmen (mit)bestimmen.
Kohl hatte in seiner ersten Regierungserklärung der 13. Wahlperiode am 23. November 1994 das Programm der christdemokratischliberalen Koalition formuliert. Für den Bereich der Innenpolitik gab er – analog zu seiner Forderung nach weniger Staat aus dem Jahr 1983 – das Ziel eines »schlanken Staat(es)« (BT Sten. Ber. 13/5: 40) aus, also die Reduzierung der Staatsaufgaben bei gleichzeitiger Rückführung der Staatsquote von bisher 52 auf 46 Prozent (BT Sten. Ber. 13/5: 41; jüngere Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ergaben, dass die Staatsquote 1994 bei nur 47,9 Prozent lag; Braakmann et al. 2005: 461). Außerdem sollte der strikte Kurs der Haushaltskonsolidierung fortgesetzt und die Steuer- und Abgabenlast für Bürger und Wirtschaft gesenkt werden.
Fast beiläufig erwähnte Kohl das Vorhaben, eine Steuerreform umzusetzen. Außerdem sollte das Steuerrecht spürbar vereinfacht (BT Sten. Ber. 13/5: 40), das Existenzminimum freigestellt, der Solidarzuschlag baldmöglichst abgebaut und die »im internationalen Vergleich wettbewerbsverzerrenden Sonderlasten« (Gewerbekapitalsteuer, betriebliche Vermögenssteuer, Gewerbeertragsteuer) abgeschafft werden.
Faktisch blieben Kanzler und Koalition damit ihrem seit zwölf Jahren nahezu unveränderten »finanzpolitischen Policy-Kern« (Grunden 2004: 54) treu: »Reduzierung der Staatsquote, Senkung der Steuern (vor allem für Unternehmen) bei gleichzeitiger Konsolidierung der Staatsfinanzen« (Grunden 2004: 54). Die entsprechenden Aussagen finden sich auch in der Koalitionsvereinbarung (11.11.1994) wieder.
Der FDP, die im Bundestagswahlkampf für weitreichende Steuersenkungen geworben hatte, war es allerdings während der Koalitionsverhandlungen nicht gelungen, die Bundesregierung auf eine Agenda zu verpflichten, die eine umfassende Steuerreform beinhaltete. Nicht einmal bei ihrer Hauptforderung, den Solidarzuschlag mit einem »klar absehbaren Ende« (Werner Hoyer in: Frankfurter Rundschau 3.11.1994) zu versehen, konnte die Partei sich durchsetzen (vgl. Heinrich 1995).
Dafür macht Ganghof vier Faktoren verantwortlich: Erstens belasteten die Kosten der deutschen Einheit die öffentlichen Haushalte nach wie vor in erheblichem Maße. Zweitens führten die umfangreichen Investitionsanreize in den östlichen Bundesländern zu einer nicht unerheblichen Minderung der Einkommensteuereinnahmen. Drittens hatte das Bundesverfassungsgericht eine Reihe von »teuren« Urteilen gefällt, wie etwa zum steuerfreien Existenzminimum (BVerfGE 82: 60) oder zur Vermögens- und Erbschaftssteuer (BVerfGE 93: 121). All dies musste schließlich unter der strengen Maßgabe der Maastrichter Euro-Kriterien geschultert werden, die eine höhere Neuverschuldung verbot. »Kurz: Der fiskalische Bewegungsspielraum war denkbar klein« (Ganghof 2004: 81). Ein riesiges Haushaltsloch verband sich im weiteren Verlauf der Legislaturperiode mit (negativen) Rekordzahlen an Arbeitslosen.
Zum weiteren Kontext der Wirtschafts- und Sozialpolitik (Bergmann 2002: 274 – 301) gehörte zudem das Scheitern des Bündnisses für Arbeit im März 1996, das als Symptom »eine[r] Abkehr vo[m] ›Kooperationskurs‹ hin zur Konfrontation mit den Gewerkschaften« (Bergmann 2002: 277) gedeutet werden kann. Das Scheitern des Bündnisses 1996 kann insofern durchaus parallel zu dem Kurswechsel unter der Regierung Schröder gesehen werden, die ebenfalls nach dem Ende der Bündnis-Bemühungen auf einen neuen Politikansatz setzte, der in der Agenda 2010 seinen Ausdruck fand (Korte und Fröhlich 2006: 295 – 315; Nullmeier in diesem Band).
Die Kohl-Regierung reagierte angesichts der schlechten Wirtschaftsdaten unter anderem mit dem »Programm für Wachstum und Beschäftigung«, das sie am 26. April 1996 in den Bundestag einbrachte. Wesentliche Punkte des Programms beinhalteten die Kürzung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall von 100 auf 80 Prozent einerseits und andererseits die Abschaffung der Vermögenssteuer.
Dazu kam die Debatte um die Reform der Rentenversicherung. Die Koalition stand einerseits unter einem Druck, handeln zu müssen, konnte aber zugleich die für sie positiven Ergebnisse der Landtagswahlen am 24. März 1996 als unerwartete Bestätigung der Bonner Regierungskoalition sehen, die »den Protagonisten die Sicherheit gab, die Einschnitte in das soziale Netz auch durchsetzen zu können und in der Bevölkerung zumindest nicht auf Ablehnung zu stoßen« (Bergmann 2002: 278). Jetzt also sollte der Versuch unternommen werden, ein ganzes Bündel von Reformmaßnahmen umzusetzen, und die Steuerreform erhielt einen neuen Stellenwert als Teil dieses Bemühens um einen Kurswechsel.
3.1 Kompetenz: Problemerkennung ohne Problembearbeitung
Parallel zu den Beratungen in diversen Kommissionen hatten nicht zuletzt der Bund der Steuerzahler und die Wirtschaftsverbände Forderungen zur Reform des Steuerrechts formuliert (Frankfurter Rundschau 26.9.1995; Die Welt 6.10.1995). Im Februar 1996 hatte auch die SPD-Opposition von der Regierung Vorschläge für eine Reform der Einkommensteuer nach den Maßgaben höherer Gerechtigkeit und einer Vereinfachung des Systems vorgelegt (vgl. Träger 2008: 53).
Die Regierung selbst hatte den Reformbedarf frühzeitig identifiziert (siehe die Einsetzung der Bareis-Kommission), dann jedoch die Behandlung des Themas verschleppt. Auch Helmut Kohl resümiert rückblickend: »Es war zweifelsohne ein Fehler, den ich mit zu verantworten habe, die Vorstellung und Diskussion der Steuer- und Rentenreform bis zur Mitte der Legislaturperiode aufzuschieben. Unser Zeitplan sah ursprünglich anders aus« (Kohl 2000: 15). Die Begründung für die Verzögerung sieht Kohl im Drängen einiger CDU-Landesverbände, vor »ihren« Landtagswahlen keine drastischen Einschnitte und Veränderungen anzupacken.
Der Reformbedarf war zwar erkannt, die Reformrichtung stand jedoch nur vage fest – und dies lag nicht zuletzt an einem Problemumfeld, das ebenso herausfordernd wie komplex war: Die Debatte um die Steuerreform verknüpfte sich mit der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, der Reform der Rentenversicherung oder der Einführung des Euro zu einem Reformknäuel, das durchweg keine positive Resonanz in der Bevölkerung fand. Die Verknüpfung der Themen untereinander war den Beteiligten durchaus bewusst, da etwa Kohl und Waigel die steuerliche Entlastung zugleich im Kontext einer höheren Eigenbeteiligung in der Renten- und Sozialversicherung sahen. Die Klärung einer eindeutigen Reformrichtung war von Beginn an durch zwei Faktoren behindert: Zum einen gab der Haushalt keinen großen Handlungsspielraum her und zum anderen trafen die Reformmaßnahmen auf breite Ablehnung in der Bevölkerung. Rasche Entlastungen der Bürger oder vergleichbare positive Parallelreformen, um diese negative Haltung zu kompensieren, waren durch die etatmäßigen Zwänge blockiert.
Im Urteil der Bevölkerung wurde die Steuerreform nach Daten des Politbarometers 1996 konsequent als nachgeordnet wahrgenommen. Die Bevölkerung sah konstant und zu zwei Dritteln die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auf Platz 1 der wichtigsten Probleme. Die Steuerreform kam mit Durchschnittswerten zwischen zehn und 15 Prozent im Jahresverlauf nie über Platz 3 der Agenda hinweg.
Gleichzeitig erwies sich das Meinungsbild als äußerst verwirrend: Die bereits beschlossene Kürzung der Lohnfortzahlung traf mit einer Ablehnung von über zwei Dritteln auf deutlichen Widerstand, während die Senkung des Spitzensteuersatzes dagegen nur von knapp 51 Prozent begrüßt wurde (Politbarometer in SZ 21.9.1996). Im Dezember 1996 fand sich ein ähnlich diffuses Bild bei der Frage, wie denn eine Steuerreform finanziert werden könne: 49 Prozent sprachen sich für die Streichung von Abschreibemöglichkeiten aus, nur 18 bzw. 15 Prozent dagegen für eine Kompensation durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer oder die Einführung einer Energiesteuer.
Weitergehende Pläne wie etwa die Besteuerung von Nacht- und Sonntagsarbeit wurden dagegen wiederum klar von 77 Prozent der Befragten abgelehnt (Politbarometer in SZ 14.12.1996). Einige der geplanten Kürzungen waren selbst innerhalb des Unionslagers nicht mehrheitsfähig. Diese Resonanz auf Eckpunkte des Konzepts deutet schon auf die Herausforderungen für die Kommunikation und Vermittlungsarbeit hin.
3.2 Kommunikation: Unklarheiten behindern Reformbereitschaft
Die konsequente und überzeugende Kommunikation des Reformvorhabens stellte sich als überaus schwierig dar. Ein Beispiel mag dies illustrieren: Bevor sich der Bundesparteitag der CDU mit dem Thema Steuerreform auseinandersetzen konnte, kam es zum Aufflammen der Diskussion um die Erhöhung der Mehrwertsteuer. Die SPD, die eine Erhöhung dieser Steuer ablehnte, argumentierte, dass diese Verbrauchssteuer Geringverdiener am stärksten belaste, da diese einen Großteil ihres Einkommens für ihre Lebenshaltungskosten ausgeben müssten. CDU-Generalsekretär Peter Hintze bestätigte die bisherige Haltung der CDU, die eine Erhöhung der Mehrwertsteuer in der laufenden Wahlperiode ausschloss, indem er verlauten ließ, es sei zu früh für verbindliche Auskünfte zu diesem Thema.
Wenige Stunden später belehrte ihn Kohl eines Besseren: In einem seiner Urlaubsinterviews verlautbarte er, eine Mehrwertsteuererhöhung sei nach 1998 unumgänglich (FAZ 10.8.1996). Was als mangelhafte Absprache erscheinen mag, offenbart ein weiteres Wesensmerkmal von Kohls Regierungsstil, der hier bewusst ein Interview in den Medien nutzte, um die Diskussionen etwa im Kabinett zu präjudizieren (vgl. Langguth 2001: 110).
Dieser Vorstoß Kohls veranlasste wiederum den niedersächsischen Oppositionsführer Christian Wulff (für den gerade der Kommunalwahlkampf begonnen hatte) zu heftiger Kritik am Kanzler. Er habe »überhaupt kein Verständnis« (SZ 17.8.1996) für Kohls Anlauf zur Erhöhung der Mehrwertsteuer und halte diesen für »einen großen Fehler« (taz 17.8.1996).
Auch die FDP nutzte die Gelegenheit zur Profilierung. Parteichef Gerhardt widersprach Kohl und sagte der »Welt am Sonntag«, wer jetzt schon beginne, »die Mehrwertsteuererhöhung für unumgänglich zu halten, bei dem ist der Durchsetzungswille für eine Steuerentlastung eher fraglich« (Welt am Sonntag 18.8.1996). In einem Interview mit dem ZDF verteidigte Kohl seinen Vorstoß mit der Aussage, man müsse auch über eine Mehrwertsteuererhöhung sprechen dürfen (Bonn direkt, ZDF 18.8.1996). Er wolle im September ein Paket vorlegen und dies mit Kanzlermehrheit abstimmen lassen. Dann würden auch die Sozialdemokraten wieder verhandlungsbereit sein.
Kohl versuchte damit den Eindruck zu vermitteln, er handle nach einem bestehenden Zeitplan für die einzelnen Schritte der Reform. Unterstützt wurde er bei der Klarstellung der Regierungsposition durch Kanzleramtsminister Friedrich Bohl. In zwei der zur damaligen Zeit eher seltenen Interviews Bohls stellte dieser klar: »Wir wollen die Bürger steuerlich entlasten. Wichtig ist, dass sich Arbeit und Leistung lohnt [...]. Wir werden Anfang des Jahres dann einen Vorschlag [den der Waigel-Kommission; A.d.V.] haben, den wir im Bundestag diskutieren und verabschieden und durch den Bundesrat zu bringen haben. Und dann soll dieses [Reformpaket; A.d.V.] spätestens zum 1. Januar 1999 in Kraft treten. Der Bürger wird deshalb vor der Bundestagswahl wissen, was auf ihn zukommt« (Das Interview, SFB 17.8.1996).
Ob eine Mehrwertsteuererhöhung dann unumgänglich sei, werde man anhand der Möglichkeiten und Notwendigkeiten feststellen. Eine höhere Neuverschuldung komme jedenfalls (angesichts der Erfordernisse der Maastricht-Kriterien) nicht in Frage. Eine solche Debatte erscheint nicht unbedingt geeignet, Problembewusstsein zu schaffen, da der Bevölkerung hier durchaus signalisiert wurde, dass einige Reformen (hier die Mehrwertsteuererhöhung) selbst in der Kernexekutive eine Frage der persönlichen Ansicht, nicht aber eine unumgängliche Notwendigkeit darstellten. Die Verknüpfung der Sachentscheidung mit der Wahlentscheidung sollte sich noch als zweischneidig erweisen.
Auch beim CDU-Bundesparteitag 1996 in Hannover waren die Eckpunkte der Reform nicht eindeutig geklärt. Im Vorfeld des Parteitags legte die Schäuble-Kommission auf der eigens dafür abgehaltenen Konferenz »Steuerpolitik für das 21. Jahrhundert« (auf Initiative Schäubles am 30.9.1996 in der Bad Godesberger Stadthalle (taz 2.10.1996)) ein Steuerkonzept vor, das als Leitantrag eingebracht werden sollte. Bundesfinanzminister Theo Waigel trat als Gastredner auf. Im Gegensatz zu Waigel, dem auf der Konferenz eineinhalb Stunden Redezeit eingeräumt wurden, erhielt Gunnar Uldall 90 Sekunden, um sein Konzept zu skizzieren (taz 3.10.1996).
Inhalt des CDU-Entwurfs war die Forderung, den Eingangssteuersatz von 25,9 Prozent auf unter 20 Prozent und den Spitzensteuersatz von 53 Prozent auf 35 Prozentpunkte zu senken. Der gleiche Satz von 35 Prozent sollte für die Körperschaftssteuer gelten. Offen blieb, ob der Einführung eines Stufentarifes gegenüber einem linearprogressiven Tarif der Vorzug gegeben werden sollte. Zur Gegenfinanzierung sah das Papier unter anderem vor, die Zuschläge von Schichtarbeit ebenso zu besteuern wie Lohnersatzleistungen.
Auf dem Parteitag, so Schäuble, sollten die Delegierten jedoch nur die Grundzüge der Steuerreform abstimmen, damit der CDU ein Spielraum erhalten bliebe (Berliner Zeitung 2.10.1996). Darüber hinaus musste die CDU-Kommission den Eindruck vermeiden, mit den Vorschlägen der offiziellen Regierungskommission unter dem Vorsitz Waigels in Konkurrenz zu treten, die ihre Ergebnisse erst zum Jahresende vorlegen wollte. Entsprechend hatte Schäuble die Ansätze der CDU mit der Waigel-Kommission abgestimmt (Interview Schäuble, ARD 7.10.1996) und nicht so detailliert ausgearbeitet, als dass sie der als wichtiger eingeschätzten Regierungskommission hätten den Weg verbauen können (NZZ 2.10.1996). Damit war jedoch zugleich die Chance eingeschränkt, klare Deutungsmuster zu etablieren.
Ende November 1996 kristallisierte sich zudem heraus, dass die Koalition ihre Strategie hinsichtlich des Zeitplans der Steuerreform modifizieren musste. Zunächst noch von Regierungssprecher Peter Hausmann dementiert, zitierte die »Welt am Sonntag« Kohl, der im Gespräch mit CDU-Politikern gesagt habe: »Wir dürfen nicht so verrückt sein, ohne Steuerentlastungen in den Bundestagswahlkampf zu ziehen, während SPD und FDP massive Entlastungen fordern. Schon Adenauer hat gesagt: Wahlen gewinnt man nur mit dem Portemonnaie der Bürger« (Welt am Sonntag 24.11.1996; General-Anzeiger 25.11.1996).
Hinter diesem Vorstoß, den Waigel wenig später bestätigte (Welt am Sonntag 1.12.1996), stand ein klares Kalkül: Die Teile der Steuerreform, die Entlastungen bringen, sollten bereits 1998 in Kraft treten; jene Regelungen, die für die Refinanzierung der Reform sorgen sollten, erst nach der Wahl. Außerdem könne man so hoffen, dass viele Besserverdienende 1998 die letztmals geltenden Abschreibungsmöglichkeiten nutzen und investieren würden. Der davon ausgehende Sonderimpuls zur Konjunkturbelebung würde der Regierung zugeschrieben werden.
Bevor die konkreten Vorschläge der Reformkommission Waigels veröffentlicht wurden, kam es jedoch erneut zum Eklat. Christian Wulff hatte aus Niedersachsen im Gespräch mit der »Hannoverschen Allgemeinen« eine Kabinettsumbildung ins Gespräch gebracht. Die Unzufriedenheit in der Sachpolitik hatte merklich auf die Machtpolitik übergegriffen. Wulff forderte: »Wenn sich der Eindruck erhärtet, dass die Steuerreform im Gestrüpp einer diffusen Diskussion stecken bleibt, muss auch an eine Kabinettsumbildung gedacht werden« (Hannoversche Allgemeine 18.1.1997).
Die Vokabel von der »diffusen Diskussion« nahm dabei direkt auf das bereits angesprochene Defizit bei der Etablierung klarer Deutungsmuster Bezug. Die Debatte um mögliche Nachfolger Waigels im Amt des Finanzministers (genannt wurden Stoiber, Seiters oder Gerhardt) kam für die Union denkbar ungelegen. Sofort griff Kohl ein und nannte eine Ablösung Waigels völlig abwegig (Tagesspiegel 20.1.1997). In den ARD-Tagesthemen wehrte sich der Bundesfinanzminister gleichzeitig mit dem Hinweis, dass der Angriff Wulffs in Wahrheit auf Kohl und Schäuble ziele (Tagesthemen, ARD 20.1.1997). Dass Kohl unter Beschuss stand, glaubte auch ein nicht genanntes führendes Kabinettsmitglied. Der Kanzler wehre jeden Angriff auf seine Politik sofort ab – dies seien erste Zeichen von Verteidigung und Schadensbegrenzung (Kieler Nachrichten 20.1.1997).
Für die Kommission Waigels war längst absehbar, dass der angestrebte Termin nicht eingehalten werden konnte. Statt Ende 1996 legte sie ihren Bericht, die »Petersberger Steuervorschläge«, am 22. Januar 1997 vor (Bundesministerium der Finanzen 1997b). Das Gremium hatte einen schwierigen Balanceakt zu vollführen: »Einerseits brauchte [es] einen Körperschaftsteuersatz, der trotz Gewerbesteuer niedrig genug war, um im Steuerwettbewerb bestehen zu können. Andererseits mussten sich die Steuersatzsenkungen einigermaßen in Grenzen halten, damit die Reform finanzierbar blieb« (Ganghof 2004: 88).
Aktuell galt eine Gesamtbelastung von etwa 57 Prozent auf Körperschaftsgewinne, die Deutschland einen erkennbaren Nachteil im Standortwettbewerb einbrachte. Wegen der starken Konkurrenz strebten in der 13. Legislaturperiode fast alle Parteien einen Körperschaftssteuersatz von etwa 35 Prozent an, sodass eine Senkung dieses Satzes um zehn Prozentpunkte »politisch ohne weiteres durchsetzbar gewesen« (Ganghof 2004: 82) wäre.
Dass dies nicht so einfach war, lag an dem Problem des Abstands zum Spitzensteuersatz der Einkommensteuer, der so genannten Satzspreizung. Der Meinung einiger Steuerrechtsexperten, die den Standpunkt vertraten, eine zu große Spreizung der Spitzensätze von Körperschaftssteuer und Einkommensteuer sei verfassungswidrig, schloss sich im Februar auch der Bundesfinanzminister an (FAZ 25.2.1997).
Die konkreten Aussagen zur Gestaltung der Mittel und Ziele der Steuerreform waren damit nicht nur zwischen verschiedenen Repräsentanten des strategischen Machtzentrums unterschiedlich – einzelne Akteure, darunter auch der Bundeskanzler, mussten eingenommene Positionierungen wiederholt räumen. Inmitten dieser Relativierungen und Vielstimmigkeit war es noch nicht gelungen, die wesentlichen Leitideen der Reform konsequent zu kommunizieren.
3.3 Durchsetzungsfähigkeit: geringe Erfolgsaussichten und fehlende Gelegenheitsfenster
Tatsächlich hatte sich die Koalition in eine schwierige Situation gebracht. Kohl selbst resümierte: »Wir waren regelrecht eingeklemmt zwischen der Wirtschaft, die uns Stillstand bei wichtigen Reformvorhaben vorwarf, einer Opposition, die die Reformen blockierte, und einer Bevölkerung, die die Reformen fürchtete« (Kohl 2000: 16).
Die Petersberger Steuervorschläge vom Januar 1997 müssen in diesem Kontext gleichwohl als ein mutiges Programm angesehen werden. Im Mittelpunkt des Konzepts stand die Senkung des Körperschaftssteuersatzes von 45 Prozent auf 35 Prozent, sodass sich zusammen mit dem auf 5,5 Prozentpunkte abgesenkten Solidaritätszuschlag und der Gewerbesteuer ein Steuersatz von durchschnittlich 48 Prozent gegenüber den bisherigen 57 Prozent ergeben hätte.
Diesem Konzept hätte ein Spitzensteuersatz von 35 Prozent für die persönliche Einkommensteuer entsprochen. Da dieser jedoch zu drastischen Einnahmeausfällen geführt hätte, schlug die Kommission einen oberen Steuersatz von 39 Prozent vor, senkte aber die Einkommensgrenze für diesen Satz deutlich. Daraus resultierte eine stärkere Entlastung für die oberen Einkommen (bis zu 14 Prozent), jedoch nur eine leichte Entlastung der unteren und mittleren Einkommen (etwa drei Prozent). Im Gegenzug sollte darum der Eingangssteuersatz von 25,9 Prozent auf 15 Prozentpunkte abgesenkt werden.
Das Volumen der Vorschläge umfasste über 80 Milliarden DMark, zu denen weitere 7,5 Milliarden durch die Senkung des Solidaritätszuschlags kamen. Durch die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage sollte knapp die Hälfte der Einsparungen refinanziert werden. Im Bereich der Unternehmen waren die Streichung von Sonderregelungen sowie die striktere Auslegung der Regeln bei der Gewinnermittlung geplant. Für Arbeitnehmer entfiel nach dem Plan die Steuerfreiheit für Feiertags- und Nachtarbeit, die Werbungskostenpauschale wurde gekürzt und die Einnahmen aus der gesetzlichen Rentenversicherung sollten bis zu deren Hälfte besteuert werden. Dreißig Milliarden D-Mark waren als Nettoentlastung geplant, die bei den Steuerzahlern verbleiben sollte.
Wie bereits erwähnt, wandelte sich der Stellenwert der Steuerreform innerhalb der strategischen Prioritätensetzung der Regierung: Das Thema wurde ihr – trotz der generellen Verpflichtung auf eine Reform der Steuerpolitik in der Koalitionsvereinbarung und im Regierungsprogramm – mehr oder weniger aufgedrängt und bot sich schließlich als Aufhänger für eine Revitalisierung der wirtschaftspolitischen Leistungsfähigkeit der Koalition an.
Der Prozess hin zur Steuerreform 1998 offenbarte dann jedoch mehr die Grenzen bzw. die verbrauchten politischen Ressourcen der Koalition, als dass er diese hätte erneuern können. Die Abwägung politischer Profilierungschancen und öffentlicher Reformerwartungen muss dabei im Falle der Steuerreform 1998 als nicht notwendigerweise gleichgerichtet bzw. sich gegenseitig verstärkend angesehen werden.
Die Bewertung der Erfolgsaussichten blieb dabei im Übrigen realistisch und vorsichtig. Der Vorwurf der Blauäugigkeit kann in diesem Zusammenhang kaum einem Akteur gemacht werden – die schlechten Aussichten für das Reformwerk hatten ja gerade dazu geführt, dass die Anstrengung mehrmals verzögert worden war. Ein Gelegenheitsfenster hatte sich nicht aufgetan – im Gegenteil: Wirtschaftlicher und budgetärer Druck hatten das Problem auf die Agenda gebracht.
Der Verhandlungskorridor war sowohl in der Sache als auch im Verfahren mit Blick auf potenzielle Kooperationspartner bzw. Gegenspieler äußerst gering. Die zu erwartenden Widerstände von verschiedenen Seiten waren hinlänglich bekannt. Zugleich hatten alle Beteiligten schon 1996 fest die nächste Bundestagswahl im Blick. Dies sollte insbesondere die Dynamik in Politikformulierung und Entscheidung bestimmen.
4 Politikformulierung: die Petersberger Steuervorschläge
Die Petersberger Steuervorschläge läuteten die Phase der konkreten Politikformulierung und Entscheidung ein. Zugleich wurden Alternativen – auch im Kontakt mit dem Koalitionspartner und der Opposition – erwogen.
4.1 Kompetenz: Konzept und Kompromiss
Trotz heftiger Meinungsverschiedenheiten im CDU-Bundesvorstand zwischen Kohl und Blüm, der eine im Petersberger Konzept fehlende verbindliche Zusage über die Erhöhung der Mehrwertsteuer zugunsten der Rentenversicherung forderte, wurde der Entwurf zwar bei vier Gegenstimmen (Blüm, Geißler, Graf Schwerin und Wulff; FAZ 24.1.1997) angenommen, im Wortlaut allerdings nur begrüßt und nicht gebilligt. Kohl schien keinen Wert auf eine substanzielle Debatte im Kreise der Mitglieder des Parteivorstands zu legen, da er das 40-Seiten-Papier erst kurz nach Beginn der Sitzung verteilen ließ, sodass nur Zeit für eine oberflächliche Lektüre blieb.
Was als effiziente Entscheidungsvorbereitung gedeutet werden mag, kommentierte damals nicht nur »Die Zeit« als Abnutzungserscheinung der Regierungspolitik: »›Reformen‹ werden im trauten Koalitionszirkel austariert. Zu mehr, zu öffentlichem Verhandeln, gar zum Austesten von Alternativen, reichen die Kraft und der Atem der Koalition nicht« (Die Zeit 24.1.1997).
Die erste Reaktion von Seiten der SPD war deutlich ablehnend. Die Sozialdemokraten wiesen besonders die Besteuerung der Schichtarbeit, die höhere Mehrwertsteuer und die unausgewogene Entlastung der verschiedenen Einkommensgruppen zurück. Ihr Vorsitzender Lafontaine formulierte apodiktisch: »Sie glauben doch im Ernst nicht, dass so etwas Gesetz wird« (Bild 25.1.1997). Eine Zustimmung sei völlig ausgeschlossen.
Daran änderte einstweilen auch die öffentliche Aufforderung Schäubles an Lafontaine nichts, die Umsetzung des Konzepts nicht zu blockieren. Es gehe jetzt nicht, so Schäuble, »um Profilierung oder das kleinliche Sammeln von Punkten, sondern um die Zukunft unseres Landes.« Obwohl er der SPD attestierte, »überhaupt keine Alternative, ja nicht einmal tragfähige Gegenvorschläge in Einzelpunkten« zu haben, sei die Regierungskoalition jederzeit bereit, mit den Sozialdemokraten in ernsthafte Gespräche über die Verwirklichung der Steuerreform einzutreten (Pressemitteilung der CDU/ CSU-Fraktion 24.1.1997).
Gleichwohl enthielt das Angebot des Unionsfraktionsführers an die SPD, gemeinsam Handlungsoptionen zu sondieren, keinerlei konkrete Kompromissvorschläge. Stattdessen unterstrich es die Überzeugung, mit den Petersberger Steuervorschlägen die richtigen Lösungsansätze gefunden zu haben. Lösungsalternativen zu bewerten, hielt das Regierungslager angesichts der frischen Vorschläge der Waigel-Kommission offenbar für nicht angebracht. Stattdessen wolle man dafür sorgen, dass die Änderungen zügig im Kabinett entschieden würden und dann Ende 1997 im Gesetzblatt stünden (Interview Bohl, WAZ 30.1.1997).
Während die Industrie positiv reagierte, protestierten Bauern, Gewerkschaften und Versicherer. Bei einer Forsa-Umfrage zeigte sich, dass die Wahrnehmung der Steuerreform in der Bevölkerung weiterhin denkbar schlecht war: Auf die Frage »Profitieren Sie von der Steuerreform?« antworteten nur zwölf Prozent mit »Ja«, 76 Prozent hingegen mit »Nein«. Die Antworten auf die Frage, ob mehr Arbeitsplätze entstünden, fielen ähnlich aus. Dass Waigel die Steuerreform geglückt sei, hielten nur acht Prozent für zustimmungsfähig; weniger geglückt sagten 43 Prozent und 36 Prozent der Befragten hielten die Reform gar für misslungen (Forsa-Umfrage veröffentlicht am 27.1.1997; fehlende Anteile »k. A./weiß nicht«). Hier war noch erhebliche Überzeugungsarbeit zu leisten, wenn die fest sitzende Ablehnung der Reform in Zustimmung oder zumindest Duldung umgewandelt werden sollte.
4.2 Kommunikation: Schwierigkeiten beim Vertrauensaufbau
Der Widerstand aus den eigenen Reihen war damit bereits in der Phase des Agenda-Setting vorprogrammiert. Kohl war unter anderem wegen des Landtagswahlkampfes in Hessen bestrebt, die Wogen zu glätten (Kohl in einem Bericht von Norbert Lehmann, ZDF 25.1.1997). Immer mehr Spitzenpolitiker der Koalition waren unzufrieden mit der Informations- und Kommunikationspolitik des Regierungsbündnisses. Schlimm sei vor allem, so kritisierten sie, dass viele Rentner durch die Diskussion um die Besteuerung der Renten verunsichert seien, real betreffe es doch nur ganz wenige.
Auch die Diskussion um die Erhöhung der Mehrwertsteuer sei verfrüht – Mitschuld daran trage Kohl. Aus der CDU-Spitze hieß es: »Man blickt langsam nicht mehr durch« und »Wir brauchen endlich eine strukturierte, klar gegliederte und vom Kanzler geführte Diskussion. Sonst schlittern wir in eine Diskussionskatastrophe« (Die Welt 29.1.1997). In Verstärkung des schon angedeuteten Übergreifens der Unzufriedenheit in der Sachpolitik auf unmittelbare Machtfragen stellte »ein Kohl-Vertrauter« fest: »Erstmals seit 1989 haben wir eine Debatte um die Führungsfähigkeit des Kanzlers« (Stern 6.2.1997). Wenngleich Kohl und sein Kanzleramtsminister Bohl, die sich über weite Strecken der Steuerdiskussion in der Öffentlichkeit zurückgehalten hatten, dem erwähnten Vorwurf nun mit erhöhten Kommunikationsbemühungen und Präsenz begegneten (vgl. Interviews oder Wortmeldungen Bohls: WAZ 30.1.1997; Kölner Stadt-Anzeiger 10.2.1997; Inforadio 12.2.1997; ZDF und ARD 14.2.1997; Express 22.2.1997 sowie DLF 25.2.1997), gab es noch immer Zweifel am Konzept.
Mit Blick auf die SPR-Anforderung einer klaren und positiven Reformsprache hatten die Petersberger Steuervorschläge schon im Titel eine gewisse Ambivalenz aufzuweisen: Der Begriff »Vorschlag« enthält sowohl ein Element der Vorläufigkeit als auch eines der Bescheidenheit im Angesicht möglicher Alternativen. Die Rede von »dem« Petersberger Steuer-»Konzept« oder auch -»Paket« hätte hier einen deutlicheren Gestaltungsanspruch markieren können. Dieser wäre jedoch andererseits wieder mit dem Umstand kollidiert, dass sowohl die Unionsparteien als auch die Opposition und die Landesregierungen noch auf dieses Konzept reagieren mussten und gegebenenfalls Änderungen anmelden würden.
Da nun der Steuerdiskurs mit der Vorlage der Kommissionsvorschläge eine Phase erreicht hatte, in der um das Gelingen der »Jahrhundertreform« hätte gekämpft werden müssen, erhofften sich einige Unionspolitiker spätestens mit der am 31. Januar 1997 anstehenden Regierungserklärung Kohls eine Orientierung und eine klare Richtungsvorgabe (vgl. BT Sten. Ber. 13/155). Kohl hatte die Regierungserklärung bezeichnenderweise unter den Titel »Gemeinsame Verantwortung für mehr Beschäftigung in Deutschland« gestellt.
Die Medien berichteten von weitreichender Enttäuschung angesichts des Tonfalls der Erklärung, die nach dem Motto »Keine Aufregung, er, Kohl, werde es schon richten« (WAZ 1.2.1997) zu verstehen sei. Wörtlich hatte Kohl gesagt: »Die Bundesregierung und die Koalition von FDP und CDU/CSU jedenfalls lassen sich nicht dabei [bei der Steuerreform, A.d.V.] beirren, die notwendigen Entscheidungen für die notwendigen Reformen herbeizuführen« (BT Sten. Ber. 13/155: 13953).
Diese affirmative Betonung der eigenen Gestaltungsfähigkeit stand jedoch zu sehr im Schatten der absehbaren Mitwirkungsrechte der Opposition im Bundesrat. Realistische Erwartungen und Glaubwürdigkeit wurden damit gerade nicht erzeugt. Kohls Appell an Opposition und Landesregierungen ging zudem in einer teils aufbrausenden Debatte unter, in der Lafontaine den Kanzler als »Ursache unserer Krise« (BT Sten. Ber. 13/155: 13963) bezeichnete.
Später, im Kontext des bevorstehenden Steuergipfels, war es Kohl dagegen bei einer Grundsatzrede vor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion durchaus gelungen, die Union auf die vorgezogene Steuerreform einzuschwören. In der von Fraktionsmitgliedern als bewegend und mitreißend beschriebenen Ansprache unterstrich Kohl, er werde mit großem Kampfeswillen in die Auseinandersetzung gehen. Die Fraktion habe mit lang anhaltendem Beifall reagiert (Welt am Sonntag 23.2.1997).
Es schien zu diesem Zeitpunkt, als sei es Helmut Kohl zumindest geglückt, die Reihen der Union zu schließen und sich damit mehr Verhandlungsspielraum zu verschaffen. Doch auch dieser Erfolg war nur eine Momentaufnahme im gesamten Prozess. Im Juni 1997 musste das Reformkonzept deutlich überarbeitet werden. Angesichts einer verfahrenen Situation mit Blick auf den Bundesrat kam es zum Versuch eines Befreiungsschlages, den der Bundestagsabgeordnete Peter Rauen in einer Fraktionssitzung vorbereitete, indem er forderte, die gesamte Steuerreform auf 1998 vorzuziehen. Diesem – wohl im Voraus abgestimmten – Vorschlag stimmten Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble zu (Die Welt 5.6.1997).
Wenige Tage später entschloss sich die Unionsfraktion im Bundestag zu weitreichenden Änderungen am bisherigen KoalitionsSteuerkonzept, die bis zu den Beratungen des Entwurfs am 26. Juni (BT Sten. Ber. 13/183) eingearbeitet werden sollten (Die Welt 12.6.1997). Ziel war es, unpopuläre Kapitel der Reform zu entschärfen. So sollte etwa die Besteuerung der Feiertags- und Nachtarbeit erst 2003 voll in Kraft treten, bei Lebensversicherungen nur die Prämien besteuert werden und der Freibetrag für Landwirte nicht gestrichen, sondern von 2.000 auf 1.300 D-Mark gesenkt werden (Die Welt 12.6.1997).
Diese Zugeständnisse änderten nichts an der herrschenden prekären Lage. Im laufenden Haushalt fehlten allein 30 Milliarden DMark. Kanzleramtsminister Bohl kündigte daher an, dass es für 1997 einen Nachtragshaushalt geben und die Bundesregierung ausnahmsweise eine höhere Neuverschuldung in Kauf nehmen werde. Damit prophezeite er, dass die Regierung für 1997 eine Störung des wirtschaftlichen Gleichgewichts feststellen müsse (SZ 21.6.1997).
Diese Hiobsbotschaft war der Auslöser, dass sich die Abgeordneten der Unionsfraktion zu Wort meldeten und ihrem Ärger Luft machten. Die Parlamentarier fühlten sich spät oder falsch informiert. Sie würden in ihren Wahlkreisen zunehmend mit unangenehmen Fragen konfrontiert, auf die es aus Bonn keine Antwort gebe. Ihre Sorge sei, dass ausgerechnet die bürgerliche Regierungskoalition ihre Kompetenz in der Wirtschafts- und Finanzpolitik verliere. Zudem würden sie von der Koalitionsführung teilweise erst dann informiert, wenn sie die Entscheidungen bereits der Presse entnommen hätten (SZ 24.6.1997).
Dabei war die Kommunikation gegenüber der Partei nur eine Ebene, auf der Vertrauen aufgebaut und Dialog hätte etabliert werden müssen. Nicht zu unterschätzen war neben der SPD auch der Widerstand der Arbeitnehmerschaft gegen die Steuerreformpläne. Die Gewerkschaften IG Metall und die Gewerkschaft öffentliche Dienste (ÖTV) kritisierten insbesondere die Pläne der Besteuerung von Feiertags- und Schichtarbeit (FAZ 26.2.1997). Karl Heinz Däke, Präsident des Bundes der Steuerzahler, machte für die Unzufriedenheit der Bevölkerung die Koalition verantwortlich, der es bisher nicht gelungen sei, die an sich richtigen Konzepte ihres Reformvorhabens der breiten Öffentlichkeit verständlich zu vermitteln (Handelsblatt 28.2.1997).
Wichtig waren dabei nicht zuletzt belastungsfähige Zahlen. Die SPD monierte eine Finanzierungslücke von 44 Milliarden D-Mark in der Konzeption der Bundesregierung (FAZ 22.2.1997). Tatsächlich wurden eine Reihe von Einsparmöglichkeiten im Haushalt geprüft. Im Bereich der Bergbausubventionen des Bundes wurde ein Sparpotenzial von zirka fünf Milliarden D-Mark ausgemacht.
Nachdem das Bundesverfassungsgericht am 11. Oktober 1994 den Kohlepfennig für verfassungswidrig erklärt hatte (BVerfGE 191: 186), war der Bund mit einer Subvention aus dem Staatshaushalt eingesprungen, weil sonst der Steinkohleabbau nicht wettbewerbsfähig gewesen wäre. Im Frühjahr 1997 sollten diese Unterstützungsleistungen von 9,1 auf 3,8 Milliarden D-Mark reduziert werden (FAZ 8.3.1997). Die Ankündigung einer drastischen Senkung der Bundessubventionen für den Kohlebergbau musste jedoch bei den ohnehin schon kritisch eingestellten Gruppierungen der Arbeitnehmerschaft wie ein Verstärker für ihren Unmut wirken. In Bonn kam es zu massiven Berg- und Bauarbeiterdemonstrationen, sodass die Wochenzeitung »Die Zeit« fragte: »Wer führt in Bonn eigentlich noch Regie?« (Die Zeit 14.3.1997).
Die Demonstrationen zeigten augenfällig, dass es der Regierung nicht gelungen war, zur Absicherung ihrer Politikformulierung und -entscheidung Dialogformen zu etablieren. Im Schäuble-Lager musste man zugeben, dass man die Bergarbeiterproteste und die politische Dynamik »so nicht erwartet« habe (Die Zeit 14.3.1997). Dies führt direkt zu der Frage, ob und wenn ja wie bei der Suche nach Bündnispartnern und öffentlichem Rückhalt gegebenenfalls auch eine Anpassung der Verhandlungsstrategie vorgenommen wurde.
4.3 Durchsetzungsfähigkeit: fehlender Konsens und Mehrheitssuche
Waren die Forderungen der Opposition von der Exekutive bisher meist zurückgewiesen worden oder unbeachtet geblieben, zeichnete sich nun ein Prozess ab, innerhalb dessen sich die Bundesregierung mehr und mehr mit der (Verhinderungs-)Macht der SPD auseinandersetzen musste, um gegebenenfalls schon im Vorfeld eines offiziellen Vermittlungsverfahrens eine Annäherung oder teilweise Verständigung zu erreichen.
Auf die Forderung Lafontaines, die Reform müsse bereits 1998 in Kraft treten – oder gar nicht, reagierte Finanzminister Waigel behutsamer als sonst: »Wir sind bereit, die Steuerreform schon zum 1. Januar 1998 umzusetzen. Dazu müssen Sie [gemeint ist Lafontaine, A.d.V.] unsere Vorschläge aufgreifen [...] und auf ein Vermittlungsverfahren verzichten« (BT Sten. Ber. 13/155: 13968). Hier ist also durchaus ein Versuch zu erkennen, die Verhandlungsstrategie in Richtung einer Konsensorientierung anzupassen, indem man den SPD-Forderungen entgegenkam und Flexibilität in der Ausgestaltung der Reform ankündigte.
SPD-Fraktionsgeschäftsführer Peter Struck nutzte das Verhandlungsangebot der Regierungskoalition und regte ein Treffen zwischen Bundeskanzler Kohl und SPD-Parteichef Lafontaine sowie den beiden Fraktionsvorsitzenden Schäuble und Scharping an. Sowohl die CSU als auch die Liberalen reagierten erwartungsgemäß empört. Spitzengespräche ohne Beteiligung der FDP »bedeuten das Ende der Koalition in Bonn« (Jürgen Koppelin, FDP-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein, Kölner Stadt-Anzeiger 10.2.1997).
Auch CSU-Chef Waigel, der nicht bei den Gesprächen dabei gewesen wäre, reagierte verärgert auf den Versuch, einen Keil in die Koalition zu treiben. Das Bemühen, Bündnispartner zu gewinnen, führte also in ein Dilemma, da Partner außerhalb der Koalition nicht als Ergänzung, sondern Infragestellung des eigenen Beitrags zur Reform gesehen wurden. Dass das von Struck vorgeschlagene ViererTreffen nicht zustande gekommen war, versuchte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rudolf Scharping in politisches Kapital umzumünzen. Er habe gelernt, »dass der Bundeskanzler nicht mehr so ohne weiteres für die ganze Koalition reden kann.« Und weiter: »Das ist verständlich, diese Koalition ist zerstritten, sie hat keine innere Substanz mehr« (ARD 13.2.1997).
Um diesem Vorwurf zu begegnen, trat Friedrich Bohl nach einer Koalitionsrunde vor die Presse: »Die Koalitionsrunde war sich heute einig, auf die SPD zuzugehen, um die aktuellen steuerpolitischen Fragen zu erörtern« (ARD 14.2.1997). Gleichwohl hatte die SPD ihr Ziel erreicht, ihren Parteivorsitzenden Lafontaine durch direkte Gespräche mit Kohl über die Steuerreform aufzuwerten.
Der Bundeskanzler hingegen schien sich der Situation bewusst, dass man andernfalls in gleicher personeller Konstellation im Herbst unter dem Druck der näher rückenden Wahl im Vermittlungsausschuss verhandeln würde. Darum zeigte er sich im Vorfeld der Gespräche nicht nur offen für Überlegungen, Teile der Steuerreform bereits auf den 1. Januar 1998 vorzuziehen, sondern war der SPD auch beim Tagungsort entgegengekommen – wiederum kam es also zur Anpassung der Verhandlungsstrategie in Richtung Konsens (Express 23.2.1997).
Das Treffen der Koalitionsspitzen mit der SPD-Delegation am 24. Februar 1997 (es nahmen nur zwölf Personen teil: Helmut Kohl, Theo Waigel, Friedrich Bohl, Wolfgang Schäuble, Michael Glos, Wolfgang Gerhardt, Hermann Otto Solms, Oskar Lafontaine, Rudolf Scharping, Ingrid Matthäus-Maier, Henning Voscherau und Heinz Schleußer) blieb jedoch ohne Durchbruch.
Die Sozialdemokraten stellten die Zahlen der Koalition als Grundlage für die Rechnungen zur Steuerreform abermals in Frage, sodass ein Abgleich zwischen dem Bundesfinanzministerium und dem nordrhein-westfälischen Finanzministerium verabredet wurde. Lafontaine erklärte rückwirkend: »Bei den Verhandlungen musste ich ständig aufpassen, dass unsere Verhandlungskommission [...] der anderen Seite nicht zu weit entgegenkam. [...] Insbesondere der Fraktionsvorsitzende Scharping war immer wieder versucht, der CDU steuerpolitisch sehr weit entgegenzukommen« (Lafontaine 1999: 62). Ein Scheitern des Dialogversuches war jedoch nach dem ersten Treffen auch nicht attestiert worden. Den Wunsch des SPD-Vorsitzenden, die Gespräche mögen doch auch weiterhin in dieser Zusammensetzung fortgeführt werden, konnte Kohl reaktionsschnell abwenden, indem er vorschlug, für die Anschlussgespräche solle jede Seite drei Vertreter benennen (Die Welt 26.2.1997). Mit dem Rückzug Kohls war Lafontaine gezwungen, sich ebenfalls zurückzuziehen, wollte er als Kohl ebenbürtig wahrgenommen werden.
Bei einem zweiten Gespräch noch in derselben Woche (am 28. Februar 1997) blieben beide Seiten zwar im Wesentlichen bei ihren Vorstellungen, meinten aber auch, »beim Verhandlungspartner jeweils in bestimmten Punkten Bewegung erkannt zu haben« (Zohlnhöfer 1999: 332). So schien sowohl bei der Besteuerung der Nacht- und Feiertagszuschläge als auch bei der Senkung der Lohnnebenkosten ein Kompromiss möglich (Der Spiegel 3.3.1997).
Diese Fortschritte wurden durch die Eskalation um die Kohlesubventionen zunichtegemacht. Während also noch keine Einigung mit der SPD in Sicht war, die vielleicht den öffentlichen Rückhalt für Reformen hätte vergrößern können, war es gerade der Mangel an öffentlicher Unterstützung, der es der SPD ermöglichte, sich ohne großen Schaden und mit Bezug auf die Proteste aus den Steuergesprächen zurückzuziehen. Sie sagte ihre Teilnahme am dritten Steuertreffen ab, obwohl die Koalition zuvor ein Kompromissangebot vorgelegt hatte, nach dem die Forderungen der Sozialdemokraten nach einem höheren Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer schrittweise hätten erfüllt werden können (Tagesspiegel 24.2.1997).
Für die Rückkehr der SPD an den Verhandlungstisch stellte Lafontaine zunehmend inhaltliche Bedingungen, die von der Koalition abgelehnt wurden, wie etwa eine spürbare Entlastung der Arbeitnehmer. Deshalb sei davon auszugehen, so Hendrik Träger, »dass eine auf Druck der SPD durchgeführte und den sozialdemokratischen Forderungen folgende finanzielle Entlastung der Arbeitnehmer im Wahlkampf eingesetzt werden sollte, um so die Wahl als ›Steuersenkungspartei‹ zu gewinnen und die Regierung bilden zu können« (Träger 2008: 57).
Wie bereits mehrfach angekündigt, gab die Regierung nun parallel zu den Gesprächen mit der SPD den Startschuss für das Gesetzgebungsverfahren. Das Kabinett billigte den ersten Teil der Steuerreform, der alle Vorschläge beinhaltete, die bereits zum 1. Januar 1998 wirksam werden sollten: die Verminderung der ertragsteuerlichen Belastung für gewerbliche Einkünfte und die Reduzierung des Solidaritätszuschlags auf 5,5 Prozent (Bundesministerium der Finanzen 1997a).
Nach einem Strategiegipfel der Union im Kanzleramt verlautete, Kohl habe kaum noch Hoffnungen auf eine Einigung mit der SPD bei der Steuerreform. Deshalb setze man unter Einbringung der Petersberger Steuervorschläge in Form eines Gesetzesentwurfs (BTDrs. 13/7480) auf das offizielle Gesetzgebungsverfahren. Kohl gab sich selbstbewusst: Wenn die SPD nicht mitmache, werde die Regierung die Steuerreform allein durchbringen (WAZ 24.3.1997).
Wie die Hürde der Unterstützung im Bundesrat genommen werden sollte, blieb jedoch weiterhin offen, da auch keine Risse in der Ablehnungsfront der A-Länder zu erkennen waren. Lafontaine hält dementsprechend in seiner Rückschau fest: »Durch die Veröffentlichung des Petersberger Konzepts [...], ohne [vertrauliche und im Vorfeld stattfindende] Abstimmung mit dem Bundesrat, hatte sich die Regierung Kohl in eine schwierige Lage manövriert« (Lafontaine 1999: 62). Und weiter: »Das Petersberger Modell bot uns eine hervorragende Möglichkeit, die Regierung Kohl vorzuführen« (Lafontaine 1999: 61). Die Regierung hatte kaum Bündnispartner und öffentlichen Rückhalt sichern können und stand nun unter dem selbst auferlegten Zwang, ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Angesichts der offenkundig fortbestehenden Probleme der Durchsetzungsfähigkeit im Bundesrat erklärte sich der Bundeskanzler Anfang April erneut zu Verhandlungen mit der SPD bereit: »[...] wenn’s sein muss, ich auch persönlich« (Farbe bekennen, ARD 3.4.1997). Wenige Tage später stellte SPD-Bundesgeschäftsführer Franz Müntefering mit Genugtuung fest: »[...] ich finde gut, dass der Kanzler endlich das macht, was unsere Erwartung ist, nämlich die Sache zur Chefsache zu machen. Er ist verantwortlich. Er macht nun das, was wir wollen, er kommt nun wieder an den Tisch« (ARD 7.4.1997).
Die Verhandlungsbereitschaft Kohls bezeichnete Schäuble in einem Interview als Teil der Regierungsstrategie: »Wir würden uns eine Menge Vorwürfe einhandeln, wenn wir nichts vorlegen, weil wir das, was wir für notwendig halten, mit der Mehrheit im Bundesrat doch nicht hinkriegen. Im Moment fahren wir zweigleisig. Wir stehen zu jedem Termin während der Osterpause für Gespräche mit der SPD zur Verfügung. Sonst sehen wir uns am Ende im Vermittlungsausschuss wieder« (Die Zeit 28.3.1997).
Das schließlich angesetzte Treffen am 23. April 1997 wurde jedoch bereits nach weniger als einer Stunde ergebnislos beendet. Lafontaine bemängelte, die schriftliche Erklärung des Scheiterns seitens der Koalition sei bereits verteilt worden, bevor das Treffen beendet war (Die Welt 24.4.1997). Damit war die Chance einer Einigung im vorparlamentarischen Raum zunächst vergeben.
Parallel zu den Gesprächen mit der SPD hatte die Bundesregierung also den verfassungsgemäßen Weg der Gesetzgebung beschritten. Dazu hatte sie die Petersberger Vorschläge in zwei Gesetzentwürfe aufgeteilt: zum einen das »Steuerreformgesetz 1998«, das alle Teile der Reform beinhaltete, die auf 1998 vorgezogen werden sollten (wie die Senkung des Solidarzuschlags), zum anderen das »Steuerreformgesetz 1999«, das die weiteren Regelungen enthielt (BT-Drs. 13/ 7242 bzw. 13/7480).
Die Stellungnahme des Bundesrates (BR-Drs. 280/97 (Beschluss): 1 bzw. BT-Drs. 13/7917: 5) überraschte nicht: »Finanzpolitisch unsolide, sozial unausgewogen und wirtschaftspolitisch verfehlt«, seien die Entwürfe nicht in der Lage, die Aussichten auf eine wirtschaftliche Belebung entscheidend zu verbessern. Und trotzdem war die Front der SPD-Länder im Bundesrat keineswegs so geschlossen, wie diese Stellungnahme vermuten ließe. Neben Ministerpräsidenten wie Hans Eichel, der die Reformpläne für sein Land Hessen ablehnte (Interview, HR1 24.4.1997), gab es auch die Landeschefs Gerhard Schröder (Niedersachsen) und Kurt Beck (Rheinland-Pfalz), die angaben, im Bundesrat den Interessen ihrer Länder verpflichtet zu sein (SZ 28.4.1997).
In dieser Zeit führte Oskar Lafontaine eine Reihe von Gesprächen, um die A-Länder auf Kurs zu halten (Träger 2008: 62). Die Ministerpräsidenten waren geneigt, ihre Unabhängigkeit von ihrer Partei unter Beweis zu stellen. Die prinzipiell mögliche Auflösung des Vetoblocks der SPD stand jedoch unter der Bedingung, hinreichende Kompensationsgeschäfte anbieten zu können, für die die Regierung allerdings aufgrund der angespannten Haushaltssituation »offensichtlich keine ausreichende Verhandlungsmasse« hatte (Lehmbruch 2002: 171). Hinzu kam, dass auch christdemokratische Ministerpräsidenten wie Bernd Seite (CDU), Landesvater von Mecklenburg-Vorpommern, ankündigten, den Reformentwurf abzulehnen, wenn es keine Ausgleichsleistungen für die östlichen Bundesländer gebe (Focus 28.4.1997).
Die Steuerschätzung vom Mai 1997 offenbarte nochmals die dramatische Lage des Bundeshaushalts und führte zu einem heftigen Streit zwischen den kleinen Koalitionspartnern CSU und FDP. Als Ausgleichsmaßnahme für die prognostizierten Steuerausfälle hatte sich die Koalition bei einem Strategietreffen unter Leitung Kohls für Einsparungen und gegen Steuererhöhungen ausgesprochen (Handelsblatt 14.5.1997).
Dennoch hielt sich Waigel – neben der Privatisierung von Bundesvermögen – die Möglichkeit der Erhöhung der Mineralöl- und Mehrwertsteuer offen (Frankfurter Rundschau 20.5.1997). Dies wiederum lehnten die Liberalen bekanntermaßen grundsätzlich ab. Der FDP-Vizevorsitzende Rainer Brüderle forderte daraufhin mehr oder weniger dezent den Rücktritt des Bundesfinanzministers: »Waigel ist das Problem der CDU und der CSU, sie muss darüber entscheiden.« Für Michael Glos (CSU) war dies »eine bewusste Störung des Koalitionsfriedens« (Frankfurter Rundschau 20.5.1997).
Die dramatischen Steuerausfälle, die die Steuerschätzung voraussagte, beeinflussten auch das Steuerkonzept der SPD. Dieses hatte die Partei nach Bekanntwerden der Zahlen vorgelegt, dabei allerdings den ursprünglich enthaltenen Eingangssteuersatz von 19,5 Prozent auf 22 Prozent angehoben (Kölner Stadt-Anzeiger 24.5.1997). Insgesamt sollte das Konzept ein Volumen von 75 Milliarden D-Mark umfassen und eine Nettoentlastung von 7,5 Milliarden D-Mark enthalten. Damit waren die Sozialdemokraten, die über den längsten Zeitraum der Diskussion eine aufkommensneutrale Reform gefordert hatten, der Koalition ein Stück weit entgegengekommen.
Als Spitzensteuersatz beinhaltete der Entwurf einen Wert zwischen 45 und 49 Prozent, der damit immer noch weit über dem von der Bundesregierung geforderten Wert lag. Zur Gegenfinanzierung schlug die SPD zum einen die Erhöhung der Mineralölsteuer um sechs Pfennig pro Liter (Einnahmen: 6,5 Milliarden) und der Mehrwertsteuer um ein Prozent (16 Milliarden) vor. Zum anderen sollten 40 Milliarden D-Mark durch die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage erzielt werden. Neben der seit langem von der Partei geforderten Erhöhung des Kindergeldes sah das Konzept vor, Privatvermögen über einer Million D-Mark mit einem Prozent zu besteuern (acht Milliarden) (dpa 2.6.1997).
Der Zeitpunkt, an dem die Sozialdemokraten ihr Steuerkonzept vorlegten – nach Auskunft Henning Voscheraus aus taktischen Gründen spät gewählt (vgl. Träger 2008: 60) –, markiert für die Koalition einen weiteren Wendepunkt in der Diskussion über das Thema Steuerreform. Nach dem Milliardenloch im Bundeshaushalt, das die Steuerschätzung offenbart hatte, stellten sich zwei Fragen: Steuererhöhung ja oder nein? Und: Sollte die Absenkung des Solidaritätszuschlags verschoben werden oder nicht?
Entlang dieser Konfliktlinien bildeten sich nun deutlicher als zuvor die verschiedenen Lager innerhalb der Koalition heraus. Bekanntermaßen galt die Gruppe um Finanzminister Waigel, für die sowohl eine Erhöhung der Mehrwertsteuer als auch der Mineralölsteuer vorstellbar war, als Widersacherin der FDP, die Steuererhöhungen grundsätzlich ablehnte.
Hinzu kam nun, dass Bernhard Vogel, Ministerpräsident Thüringens, im Bundesrat eine Koalition gegen die Rückführung des Solidaritätszuschlags um sich scharte (Die Welt 29.5.1997). Die Rückweisung eines solchen Einspruchs des Bundesrates mit Zweidrittelmehrheit hätte nach Art. 77 Abs. 4 des Grundgesetzes auch einer Zweidrittelmehrheit des Bundestages bedurft, was im Fall des Solidarzuschlags als ausgeschlossen gelten konnte. Von Seiten der Liberalen verlautete dazu, es sei Aufgabe des Fraktionsvorsitzenden Schäuble, für Disziplin innerhalb der Union zu sorgen (Die Welt 29.5.1997).
Die Koalition bot in jenen Tagen ein zerstrittenes Bild. Inmitten aller Irritationen war sie noch nicht dazu gekommen, eine gemeinsame Strategie für die Auseinandersetzung mit der SPD auszuarbeiten (Bremer Nachrichten; Frankfurter Rundschau 27.5.1997). Ein nicht genannter Finanzexperte der Union monierte: »Da hat sich niemand konzeptionelle Gedanken gemacht« (Die Zeit 29.5.1997). Vor dem Zusammentreten des Vermittlungsausschusses am 4. Juli musste die Koalition entscheiden, ob sie gemeinsam mit der SPD eine Minimallösung erreichen oder an ihren Vorschlägen festhalten und damit untergehen wollte. Dieser Einsicht gewahr, nutzte Wolfgang Schäuble das Steuerkonzept der SPD als willkommenes Instrument, dem unbeugsamen liberalen Koalitionspartner zu drohen.
Indem Schäuble den Sozialdemokraten Gesprächsbereitschaft signalisierte – obwohl sich die Positionen des SPD-Konzepts kaum von jenen Lafontaines beim gescheiterten Steuergipfel unterschieden –, deutete er der FDP an, dass sich die Union notfalls auch mit der SPD auf einen Steuerkompromiss einigen könnte (SZ 28.5.1997). Weil dies das sichere Ende der Koalition bedeutet hätte, mussten sich die Liberalen entscheiden, ob sie weiterhin keine Steuererhöhung zum Stopfen der Haushaltslöcher und eine deutliche Nettoentlastung trotz leerer Staatskassen fordern wollten. Doch der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Paul Klemens Friedhoff, gab sich unnachgiebig. Rüttele die Union am Beschluss der Koalition, weder Etatlöcher mittels Steuererhöhungen zu stopfen noch den Solidaritätszuschlag zurückzuführen, so stelle sich für die FPD die Koalitionsfrage (FAZ 1.6.1997).
In den Ausschüssen des Bundestages wurde unterdessen an Änderungsvorschlägen zu den Gesetzentwürfen gearbeitet. Dabei kam es im Finanzausschuss – anders als die konfrontative Haltung der SPD erwarten ließ – in mehreren Punkten zur Zusammenarbeit zwischen Regierung und Opposition, sodass einzelne Vorschläge einstimmig verabschiedet werden konnten. Ging es etwa um die Besteuerung der Sonderzuschläge für Schicht- und Nachtarbeit, so wurde angeregt, diese über einen Zeitraum von vier Jahren einzuführen. Die Koalition ging damit auf die Sozialdemokraten zu, die in der ursprünglich geplanten Abschaffung der Besteuerungsbefreiung einen klaren Nachteil für ihre Wählerklientel ausgemacht hatten.
In der Debatte im Plenum hingegen kritisierte die SPD die zum Teil von ihr mit ausgearbeiteten Entwürfe scharf (BT Sten. Ber. 13/ 184). Der kooperativen Haltung in den Ausschüssen stand die Konfrontationsstrategie der SPD in der Öffentlichkeit gegenüber, deren Ziel es war, die Handlungsunfähigkeit der Regierung zu demonstrieren.
Obwohl die SPD nach außen deutlich gemacht hatte, dass sie zum gegebenen Zeitpunkt keine Einigungschancen sah (DLF 27.6.1997; Frankfurter Rundschau 25.6.1997), zeigte sich Kohl angesichts des Beschlusses der Steuerreformgesetze 1998 und 1999 im Bundestag mit Koalitionsmehrheit zuversichtlich, dass ein Einvernehmen mit der SPD im Vermittlungsverfahren möglich sei (Die Welt 27.6.1997). Parallel erhöhte Kanzleramtsminister Bohl den Druck auf die SPD. Die Entscheidung über die Steuerreform sei eine Nagelprobe für die Glaubwürdigkeit der Sozialdemokraten: »Wer dieses Schlüsselprojekt für Wachstum und Beschäftigung blockiert, trägt die Verantwortung dafür, dass neue Arbeitsplätze in Deutschland nicht entstehen« (Express 29.6.1997).
Der Druck blieb ohne Wirkung. Am 4. Juli lehnte der Bundesrat die Steuerreformpläne mit breiter Mehrheit ab und Wolfgang Gerhardt sprach die symptomatischen Worte: »Wir sind an der Regierung, aber nicht an der Macht« (FAZ 8.7.1997).
Währenddessen wurde im Vermittlungsausschuss weiter nach einer Mehrheit für eine Reform gesucht. Das Angebot der Koalition, statt einer Nettoentlastung von 30 Milliarden D-Mark auch mit 15 Milliarden D-Mark einverstanden zu sein, schlug die SPD aus. Ihrer Meinung nach war auch diese Summe zu hoch (FAZ 29.7.1997).
Weil dieses Angebot verhandlungsfähig hätte sein müssen, wurde in der Presse daraufhin der Vorwurf laut, die SPD stelle unerfüllbare Bedingungen (Der Spiegel 4.8.1997). Dass die Verhandlungen scheiterten, überraschte folglich nicht. Der Vermittlungsausschuss beschloss ein so genanntes »unechtes Ergebnis«, indem er den Entwurf mit den Stimmen der SPD ablehnte (BR-Drs. 528/97).
Weil die Zeit drängte – immerhin beinhalteten sowohl das Konzept der Bundesregierung als auch jenes der sozialdemokratischen Opposition Regelungen, die 1998 in Kraft treten sollten –, wurde für den 5. August 1997 eine Sondersitzung des Bundestages einberufen, auf der sich die beiden Konzepte gegenüberstanden. Erwartungsgemäß wies der Bundestag die Ablehnung des Vermittlungsausschusses mit den Stimmen der Koalition zurück (BT Sten. Ber. 13/186: 16860f.). Gebilligt wurde hingegen die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 1. Januar 1998.
Angesichts dieses Ergebnisses zeigte sich die Bundesregierung entschlossen, ein zweites Vermittlungsverfahren einzuleiten. Zeitgleich wurden Forderungen laut, die Machtbefugnisse des Bundesrats müssten langfristig begrenzt werden (so etwa Graf Lambsdorff im Interview mit der »Süddeutschen Zeitung« (8.8.1997) und BDIPräsident Henkel in der »Bonner Rundschau« (7.8.1997)).
Obwohl Schäuble der SPD weit entgegengekommen war – etwa mit der Senkung des Eingangs- bzw. des Spitzensteuersatzes auf 22 bzw. 45 Prozent –, kam keine Bewegung in die Debatte, da die Sozialdemokraten alle Vorschläge ablehnten. Vielmehr forderten sie ein gänzlich neues Konzept, das nicht nur »sozial ausgewogen und solide finanziert« (Stern 21.8.1997) sein, sondern vor allem offiziell vorgelegt werden müsse. Damit zielte die Opposition auf eine Schwachstelle des Angebots Schäubles, das zwar mit Bundeskanzler Kohl, nicht aber mit der FDP abgesprochen war.
Bewegung brachte dann die Bürgerschaftswahl in Hamburg vom September 1997. Henning Voscherau, Erster Bürgermeister der Hansestadt und SPD-Steuer-Verhandlungsführer, hatte diese verloren und war von Hans Eichel in der Funktion des SPD-Verhandlungsführers abgelöst worden (FAZ 25.9.1997). Zum einen versicherte Helmut Kohl weiterhin seine Verhandlungsbereitschaft: »Meine Hand bleibt weiter ausgestreckt« (Welt am Sonntag 21.9.1997). Jedoch forderte er die SPD auf, das Steuerkonzept der Koalition nun nicht weiter durch Populismus und Wahltaktik zu verwässern.
Zum anderen schlug Wolfgang Schäuble überraschend vor, sowohl Mehrwertsteuer als auch Mineralölsteuer könnten zur Finanzierung der Lohnnebenkosten um jeweils einen Prozentpunkt angehoben werden (Stuttgarter Zeitung 22.9.1997). Der Vorschlag traf auf Wohlwollen bei der SPD, die Schäuble für diesen Vorstoß ausdrücklich lobte (Sächsische Zeitung 24.9.1997).
Doch nicht nur die Ablehnung von Seiten der kleinen Koalitionsparteien, sondern auch die Kritik aus der CDU kam prompt. Die Stimmung in CDU und FDP sei »massiv und vehement dagegen« (FAZ 24.9.1997). Schäuble hatte diesen Vorschlag bei der Sitzung des Arbeitskreises Umweltschutz der CSU in Ingolstadt präsentiert und ihn ausdrücklich als seine eigene, nicht mit der Fraktion abgestimmte Meinung gekennzeichnet. Trotzdem musste er sich ungewöhnlich deutliche Kritik vom bayerischen Finanzminister Erwin Huber gefallen lassen: »Ich erwarte, dass sich auch der Fraktionsvorsitzende an die gemeinsame Linie der Partei hält« (FAZ 24.9.1997).
Wäre der Vorschlag von den Sozialdemokraten umgehend angenommen worden, hätte dies erheblichen Druck auf die kleinen Koalitionsparteien CSU und FDP ausgeübt, da die Einigung mit der SPD über die Steuerreform greifbar gewesen wäre. Zudem hätten die kleinen Koalitionäre den Vorschlag nur schwer öffentlich ablehnen können, ohne als Verhinderer dazustehen.
In einem Interview mit dem »Spiegel« erklärte Schäuble seinen Vorstoß damit, er habe versucht, reformwillige SPD-Ministerpräsidenten aus der Ablehnungsfront herauszulösen. Jedoch seien am Ende »alle Verhandlungswilligen [von Lafontaine, A.d.V.] wieder eingefangen« worden. Wäre der Plan aufgegangen, hätte Schäuble »leichter die Koalitionspartner auf [seinen] Kurs zwingen« (Focus 29.9.1997) können.
Zwei Auffassungen standen sich deutlicher denn je gegenüber: diejenigen, die sich – wie Schäuble – mit der SPD einigen wollten, und jene, die einen Schlussstrich ziehen wollten, falls die eigenen Vorstellungen nicht verwirklicht werden konnten. Am 17. Oktober 1997 stimmte der Bundesrat endgültig gegen die Steuerreformgesetze der Koalition. Dennoch gab die Bundesregierung die Reform nicht verloren. Bohl erhielt den Auftrag, der SPD ein abermaliges Gesprächsangebot zu übermitteln. Weil die SPD dies umgehend zu den »substanzlose[n] telefonische[n] Schnellschüssen« (SZ 13.11.1997) der Koalition zählte, beklagte Bohl: »Sich noch nicht einmal an einen Tisch zu setzen und die Überlegungen anzuhören und vielleicht darauf zu reagieren, das ist reinste Blockade – Blockade pur« (ProSieben 12.11.1997).
In der Haushaltsdebatte im Bundestag am 26. November präsentierte Lafontaine überraschenderweise den Vorschlag, »den Eingangssteuersatz auf 22 Prozent [und] den Spitzensteuersatz auf 49 Prozent zu senken« (BT Sten. Ber. 13/206: 18675). Zudem versuchte er in Interviews, dem Image des Blockierers entgegenzuwirken. Er habe schon vor Monaten verkündet: »Wenn der Dicke wirklich einen Deal mit uns will, dann sucht er den direkten Kontakt zu mir.« Er allein sei handlungs- und abschlussbereit, »in vier Stunden wäre alles zu regeln« (Der Spiegel 1.12.1997).
In der Phase aufkeimender Hoffnung wurde in vertraulichen Gesprächen zwischen Waigel, Schäuble und Solms auf der einen und Scharping und Eichel auf der anderen Seite vereinbart, die Mehrwertsteuer bereits zum 1. April 1998 um einen Prozentpunkt zu erhöhen. Oskar Lafontaine hatte, um dieses Klima nicht zu stören, auf dem Hannoveraner Parteitag (2.–4.12.1997) der SPD auf persönliche Attacken gegen den Kanzler verzichtet.
Beim folgenden Treffen einer Sechsergruppe aus hochrangigen Koalitions- und SPD-Vertretern am Abend des 10. Dezember 1997 konnte jedoch keine Einigung erzielt werden. Die Schuld daran wurde der FDP zugeschrieben. Obwohl die SPD-Verhandlungsdelegation die Bereitschaft hatte erkennen lassen, beim Spitzensteuersatz auf private Einkommen unter den bisher als Schmerzgrenze dargestellten Wert von 49 Prozent zu gehen, und Waigel und Schäuble bereit gewesen seien, eine geringfügige Erhöhung der Mineralölund Mehrwertsteuer zu akzeptieren, sei Solms strikt dagegen gewesen (SZ 12.12.1997). Zu ihrer Verteidigung brachte die FDP vor, sie habe sich zum einen in den Gesprächen zunehmend isoliert gefühlt. Zum anderen sei massiv Druck auf die Partei seitens der anderen Koalitionsparteien ausgeübt worden (SZ 11.12.1997).
Bundesfinanzminister Theo Waigel erklärte die Steuerreform für die 13. Legislaturperiode für gescheitert und gab bekannt, entgegen der Ankündigung keinen neuen Gesetzentwurf mehr vorlegen zu wollen. Stattdessen sollten die Vorschläge der Petersberger Steuerkommission in einem Regierungsprogramm für die Zeit nach der Wahl zusammengefasst werden (Hamburger Abendblatt 23.12.1997).
Damit wurde die nicht realisierte Steuerreform zu einer weiteren Illustration dessen, was Bundespräsident Herzog – an verschiedene Seiten adressiert – im April 1997 in seiner Berliner Rede deutlich als Gefahr benannt hat: »Ob Steuern, Renten, Gesundheit, Bildung, selbst der Euro – zu hören sind vor allem die Stimmen der Interessengruppen und Bedenkenträger. Wer die großen Reformen verschiebt oder verhindern will, muss aber wissen, dass unser Volk insgesamt dafür einen hohen Preis zahlen wird. Ich warne alle, die es angeht, eine dieser Reformen aus wahltaktischen Gründen zu verzögern oder gar scheitern zu lassen. Den Preis dafür zahlen vor allem die Arbeitslosen. [...] Eine Selbstblockade der politischen Institutionen können wir uns nicht leisten« (Herzog 1997).
5 Bilanz: Erfolgskontrolle
Die Kategorien und Bestandteile des SPR haben eine ganze Reihe von Defiziten aufgezeigt, die in ihrer Summe das Scheitern der Reform durchaus plausibel machen. Das SPR erlaubt, solche Defizite und Probleme systematisch zu erfassen, und identifiziert Aufgaben und Anforderungen, die strategische Reformpolitik ermöglichen. Die vielfältigen Kontingenzen und Bestimmungsfaktoren des Politischen machen die Kriterien des SPR nicht zu einem Garanten für politischen Erfolg. Sie geben jedoch Orientierung bei der Optimierung von Reformpolitik. Dazu gehört im Besonderen auch der Bereich Erfolgskontrolle, dessen Wichtigkeit das SPR für die Dauer des gesamten Reformprozesses unterstreicht und der hier abschließend thematisiert werden soll.
Viele der im SPR an dieser Stelle benannten Punkte können beim Versuch zur Steuerreform nicht nachgewiesen werden: Ausgefeilte Evaluationstechniken (die ja vor allem in der hier nicht erreichten Phase der Politikumsetzung wichtig werden) lassen sich nicht finden; einen strategischen Stakeholder-Dialog gab es ebenso wenig wie die zielgruppenspezifische Nutzung von Evaluationsergebnissen. Es wäre jedoch zu kurz gegriffen, wenn man das SPR als Checkliste verstünde, die über das Abhaken oder Fehlen bestimmter Anforderungen in der Summe Erfolg oder Misserfolg von Reformpolitik vorhersagen könnte. Jedes Reformvorhaben hat auch seine spezifische Rationalität und seinen spezifischen Kontext.
Was das SPR jedoch leisten kann, ist der Hinweis auf jene Punkte, die abseits anderer, kontingenter Variablen durchgängig die Chancen für eine erfolgreiche Politik erhöhen. Dabei lässt sich in der Summe der Schluss ziehen, dass Defizite gemäß dem SPR selten ausgeglichen wurden. Folglich kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass die Regierung den Reformversuch von Beginn an verstolpert hat und in der Folge über eine lange Zeit zwar das Fallen vermied, jedoch auch nicht wirklich Tritt fassen konnte.
Diese Dynamik erklärt sich auch aus den ambivalenten Wirkmechanismen hinter den drei vom SPR benannten Bereichsaufgaben in der Erfolgskontrolle: So wurde im Bereich »Responsivität gewährleisten« die öffentliche Resonanz durchaus auf professionellem Weg im Kanzleramt analysiert – die Umfragewerte mahnten jedoch zur Vorsicht und hielten gerade nicht zu sicherem Voranschreiten in der Reformpolitik an. Auch bewahrten sich die Verantwortlichen bis zuletzt (wenn auch kleiner werdende) Handlungsspielräume – allerdings zum Preis einer lange Zeit als diffus und unklar erscheinenden Reformbotschaft. Schließlich wurden auch Kontrollmechanismen effektiviert – allerdings wurde das zu erreichende Ziel einer erfolgreichen Reformrealisierung mehr und mehr durch das Ziel einer erfolgversprechenden Wahlkampfpositionierung überlagert.
Die Klärung der Ursache des Scheiterns wird unter anderem in der eingangs erwähnten Kontroverse zwischen Zohlnhöfer und Renzsch diskutiert. Zohlnhöfer argumentiert, dass das Beispiel Steuerreform zeige, dass »sich die Handlungslogiken von föderativem Verhandlungssystem und wettbewerbsorientiertem Parteiensystem als partiell unvereinbar erwiesen« (Zohlnhöfer 1999: 317).
Das Scheitern sei eher »der Logik des Parteienwettbewerbs als [dem] Immobilismus des politischen Systems« (Zohlnhöfer 1999: 324) geschuldet: »Alle beteiligten Parteien versprachen sich letztlich von einer Nichtentscheidung einen größeren Wahlerfolg als von einer Einigung zu den Bedingungen des Gegenspielers. Insofern sind Entscheidungsblockaden bei gegenläufigen Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat offenbar um so wahrscheinlicher, je näher die nächsten wichtigen Wahlen rücken und je positiver die Erwartungen der Beteiligten bezüglich des elektoralen ›payoffs‹ im Fall der Nichteinigung sind« (Zohlnhöfer 1999: 345).
Renzsch dagegen betont eine durchaus vorhandene Kompromissfähigkeit auch auf Seiten einzelner SPD-Länderchefs und führt das Scheitern letztlich auf die Vetoposition der kleineren Koalitionspartner CSU und FDP (Renzsch 2000: 187) zurück: »Die Steuerreform ist nicht am kompetitiv induzierten Mangel von Kooperationsbereitschaft der beiden großen Parteien gescheitert – die wollten mehrheitlich durchaus Reformen und hätten sich auf eine aufkommensneutrale Regelung verständigen können. Vielmehr scheiterte sie daran, dass ein sich abzeichnender Finanzkompromiss zwischen Bund und Ländern von den beiden kleineren Koalitionspartnern CSU und FDP, die eine deutliche Steuerentlastung zugunsten ihrer Wählerklientel und zu Lasten der Länder durchsetzen wollten, verhindert wurde« (Renzsch 2000: 190f.). Beide Positionen verbindet damit der Blick auf die auch in der detaillierten Schilderung erkennbare Wahlkampforientierung.
Aufschlussreich für die Gestaltung von Reformpolitik im Sinne des SPR sind in diesem Kontext die retrospektiven Deutungen der Steuerreform von Schäuble und Kohl – nicht zuletzt, weil sie in der Ursachenanalyse genau jene Punkte diskutieren, die auch innerhalb des SPR hohe Relevanz haben.
Schäuble bilanziert: »[Wir standen] vor dem Phänomen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung unsere Reformansätze einerseits als zu spät oder zu zögerlich eingeschätzt wurden, andererseits aber fast jeder konkrete Reformschritt den meisten Menschen schon wieder zu weit ging. Was erfolgreich zustande gebracht worden war, wurde in der Öffentlichkeit als erledigt betrachtet, ohne dass uns daraus ein längerfristig wirksamer Bonus erwachsen wäre. Dafür wirkten die ungelösten Probleme zusammen mit dem subjektiven Ärger über die eine oder andere Belastung infolge der beschlossenen Reformen massiv gegen uns. Es war wohl unser größter Fehler in diesen vier Jahren, dass wir es nicht geschafft haben, unsere Reformen in einen den Menschen plausiblen Gesamtzusammenhang zu stellen. Immer wieder waren wir konfrontiert mit enervierenden und die Ressourcen bindenden Detaildebatten. Über die Frage einer äußerst maßvollen Besteuerung von Spitzenrenten brachten es unsere eigenen Leute fertig, den großen Wurf unseres Petersberger Steuerreformkonzepts [...] schon gleich zu Anfang kaputtzureden. [...] [Dies zeigt], wie eine an vielen Problemstellen ansetzende und in eine Gesamtkonzeption eingebettete Reformpolitik im öffentlichen Kleinkrieg zerschlissen werden kann« (Schäuble 2000: 17).
Schäuble betont ebenso, dass man in der ersten Hälfte der Legislaturperiode Zeit verloren habe: »Weil Reformen in der Politik immer zunächst auf Widerstand stoßen, wurde der Zeitverlust zum zusätzlichen Problem – sowohl innerhalb der Regierungskoalition als auch hinsichtlich der verbesserten Chancen der rot-grünen Mehrheit im Bundesrat, gegen Ende der Legislaturperiode eine Blockade durchzuhalten« (Schäuble 2000: 18). Für den gesamten Prozess scheint mithin die grundsätzliche Einschätzung von Fischer, Schmitz und Seberich (2007: 212) bestätigt zu sein: »Die parteipolitischen Kräfteverhältnisse, anstehende Wahltermine sowie die jeweiligen ökonomischen Rahmenbedingungen markieren den Handlungskorridor«.
Eine besondere Problematik, die Schäuble mit seinem Verweis auf den Umgang mit den Ergebnissen der Expertenkommissionen nur tangiert, verdient Erwähnung: Wiewohl der auch im SPR unterstrichenen Notwendigkeit Rechnung getragen wurde, interne und externe Expertise auszuschöpfen, so muss gleichfalls angemerkt werden, dass ein Zuviel an Kommissionsergebnissen sowie parallel arbeitende Gremien nicht zur Verstärkung, sondern eher zur konzeptionellen Unschärfe geführt haben.
Die unterschiedlichen Resultate relativierten sich nicht nur gegenseitig, sondern konnten auch parteipolitisch genutzt werden. Lafontaine betont etwa: »Immer wieder trieben wir die Koalition [...] mit der Forderung vor uns her, auf das Bareis-Gutachten zurückzugreifen und ein entsprechendes Steuergesetz vorzulegen. Ich wusste um die Schwierigkeiten, die mit einem solchen Steuergesetz verbunden waren. Es machte mir aber Vergnügen, die Regierungsparteien mit ihren eigenen Parolen und Versprechungen in Verlegenheit zu bringen« (Lafontaine 1999: 60).
Zweifellos eröffneten die eingesetzten Expertengremien – neben den genannten dysfunktionalen Aspekten – in prozessualer Hinsicht wiederum Chancen. So wurde über die Einsetzung getrennter Kommissionen parteipolitisches Profil akzentuiert, die Involvierung unterschiedlicher Gruppen gewährleistet und – nicht zuletzt – der politische Prozess strukturiert und Zeit gewonnen: Die jeweils arbeitenden Kommissionen boten bis zur Vorlage ihrer Ergebnisse einen Zeitraum, in dem diverse Kommunikationsprozesse vorangetrieben, Positionierungen getestet und Beteiligung organisiert werden konnten. Die wiederholte Bezugnahme auf die Arbeit von Kommissionen und das Abwarten der jeweiligen Ergebnisse zeigt deutlich diese Funktionen und damit die Ambivalenz der Kommissionsarbeit.
Die verschiedenen Kommissionen standen allerdings nicht im wirklichen Zentrum der Reformpolitik. Kohl sprach nach der verlorenen Wahl 1998 deutlich von Vermittlungsproblemen und sah bereits den Beginn des Jahres 1997 von einer schlechten Stimmungslage gekennzeichnet (Kohl 2000: 14 – 19). Die Opposition habe konsequent die Pläne der Regierung als unsozial diffamiert (Kohl 2000: 16) und damit die Einsicht in die Notwendigkeiten der Reformen zusätzlich behindert: »Oskar Lafontaine machte mit starker Unterstützung des DGB erfolgreich die ›Gerechtigkeitslücke‹ zu einem Leitmotiv der gesellschaftlichen Diskussion über unsere Reformpläne« (Kohl 2000: 16). Mehr noch: Die SPD hatte im Wahlkampf ganz bewusst darauf gesetzt, den Überdruss an Reformen auch als Kritik am Wort selbst zu fokussieren.
In der Haushaltsdebatte 1998 formulierte der Kanzlerkandidat Schröder – durchaus als Echo zu vielen ähnlichen Äußerungen Lafontaines: »Wenn einer der durchschnittlich verdienenden Menschen heute das Wort ›Reform‹ nur hört, bekommt er schon einen Schrecken und denkt: Jetzt wollen Kohl und Blüm wieder an mein Portemonnaie – so verkommen ist der Reformbegriff in ihrer Regierungszeit« (zitiert nach Fröhlich 2001: 185f.).
Dabei hatte Kohl die entlastenden Effekte der Steuerreform immer als kompensatorische Maßnahme für die belastenden Effekte im Bereich der Rentenversicherung verstanden. Diese Kombination der Reformbemühungen drang jedoch nicht durch. Auch Schäuble ordnet dies ähnlich ein: »[...] Lafontaine schlug nicht so sehr auf die altsozialistische Ideologenpauke, sondern verstand es geschickt, die SPD als Wächter der sozialen Gerechtigkeit zurechtzuschminken, was ihm angesichts des Diffamierungspotenzials, das unsere Reformpolitik zwangsläufig enthielt, erlaubte, hinter dieser Maske pure Destruktion zu betreiben. Der Generalverdacht der sozialen Schieflage war nun mal unser Problem« (Schäuble 2000: 21).
Kohl hebt dabei, ebenso wie Schäuble, noch einen anderen Faktor hervor, der seine Rolle im Reformprozess massiv bestimmt habe: »Die zeit- und kräftezehrenden Verhandlungen über das europäische Währungssystem banden meine Kräfte in ganz starkem Umfang. So fehlte mir teilweise die Zeit für die Mitgestaltung und Begleitung der Reformdiskussion und für die Stabilisierung der Partei« (Kohl 2000: 18). Für Kohl war die – auch als Reformprozess zu verstehende – Einführung des Euro mit eindeutiger Priorität versehen; für dieses Ziel war er bereit, einiges zu investieren – letztlich auch die Siegchancen bei der Bundestagswahl (Leinemann 2001: 102 – 119; Dyson 1998).
Ein Stakeholder-Dialog im Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik war zwar ansatzweise im Konzept der CDU-Bundesgeschäftsstelle für den Wahlkampf vorgesehen. Allerdings ließen sich zu diesem Zeitpunkt die erhofften Verbündeten für die Reformstrategie aus der Wirtschaft und den moderaten Gewerkschaften nicht mehr mobilisieren (Bergmann 2002: 292). Die Gewerkschaften gingen nach dem Ende des Bündnisses für Arbeit und dem Eklat um die Kohlesubventionen deutlich auf Distanz zur Regierung, während sich aus der Wirtschaft durchaus wohlwollende Stimmen für den Kanzlerkandidaten Schröder vernehmen ließen.
Auch hier kam eine weitere Kontextentwicklung dazu: Die Steuerreform stand im Kontext der Haushaltslücke und Verschuldungsproblematik. Schäuble bilanziert: »Die heftige öffentliche Debatte traf uns umso unangenehmer, als mit dem Thema Staatsverschuldung ein Markenzeichen der Union, nämlich die finanzielle Solidität, in seinem Kern angegriffen wurde« (Schäuble 2000: 19).
Hier hatte beispielsweise die umstrittene und letztlich fehlgeschlagene Initiative Waigels zur Neubewertung der Goldreserven der Bundesbank im April 1997 einen verheerenden Eindruck hinterlassen (Duckenfield 1999). Zudem drohte die Regierung mit Überschreitung der Maastricht-Kriterien ihren eigenen Anspruch nicht einlösen zu können: »Aus den Ingredienzien Arbeitslosenzahlen, magere Wachstumsziffern, Reformstau und Streit um soziale Gerechtigkeit, projiziert auf die Folie einer ungewöhnlich lange amtierenden Regierung Kohl, entstand eine für die Koalition und insbesondere die Union am Ende tödliche Melange – Überdruss« (Schäuble 2000: 21). Dieser Eindruck dürfte auch dafür verantwortlich gewesen sein, dass die Blockade im Bundesrat nicht als Obstruktion der Opposition, sondern als Führungsschwäche der Regierung gedeutet wurde (Bergmann 2002: 55).
Kohl und Schäuble sind sich einig in der Schuldzuweisung gegenüber der SPD. Beide bemängeln jedoch auch die fehlende innerparteiliche Geschlossenheit und beziehen sich hier auf die Debatte um das Zukunftsprogramm im Frühjahr 1998. Der ehemalige Fraktionsvorsitzende schreibt: »Das Bedürfnis nach Reformen war auch in der Union groß. Aber es ging unseren Mitgliedern offenbar wie den meisten Menschen: Sie sahen zwar den einzelnen Schritt, nicht aber immer den Gesamtzweck, und deshalb waren sie genauso anfällig für Detailkritik, die dann schnell zur generellen Politikschelte wurde« (Schäuble 2000: 25).
Schäuble sieht zwei letztlich vergebene Chancen zur Neuorientierung und -aktivierung der Partei. Zum einen nennt er seine mit viel Beifall bedachte Rede auf dem Leipziger Parteitag im Oktober 1997: »Diesmal nutze ich die Gelegenheit, die beschlossenen Gesetze und Reformkonzeptionen in einen systematischen Zusammenhang zu stellen. Die Reaktion auf dem Parteitag und in der Öffentlichkeit war überschwänglich. Die stellvertretende Parteivorsitzende Angela Merkel, die neben mir auf dem Podium saß, meinte nach der Rede, nun wisse sie wieder, warum sie in der CDU sei« (Schäuble 1999: 25). Und weiter: »Was für viele wie Flickwerk ausgesehen hatte, bekam durch die Art der Darstellung plötzlich Sinn und Ziel« (Schäuble 1999: 25).
Dieser Eindruck, so Schäuble, wurde jedoch durch das ihn völlig überraschend treffende Interview Kohls überdeckt, in dem dieser Schäuble einerseits zum denkbaren Nachfolger erklärte und andererseits am nächsten Tag bekräftigte, im Falle eines Wahlsiegs bis 2002 im Amt bleiben zu wollen. Hier deuteten sich unverkennbar Spannungen innerhalb der Kernexekutive an.
Den zweiten Versuch zur Neuorientierung und -aktivierung der Partei sehen Schäuble und Kohl im Bemühen um ein neues Zukunftsprogramm. Schon im Wort wird deutlich, dass die Akteure in durchaus mustergültiger Art und Weise die im SPR zugrunde gelegten Imperative als relevant erachteten. Hier sollten bewusst Handlungs- und Zukunftsfähigkeit (eine entscheidende Vokabel im politischen Wettbewerb; Fröhlich 2001; 2004) bewiesen und im Sinne der Erfolgskontrolle Gesamtkosten und -nutzen bewertet werden.
Der Anlauf zum Zukunftsprogramm stellt damit ein Beispiel politischen Lernens dar, bei dem im Reformprozess flexibles Nachsteuern umgesetzt wurde. Schäuble, der für das auf dem Bremer Parteitag 1998 zu verabschiedende Programm den Vorsitz der Parteikommission innehatte, schreibt: »Es war der Versuch einer politisch nicht ganz ungefährlichen Gratwanderung. Denn einerseits wollten wir nach 16 Jahren Regierungszeit auf eine allzu selbstgerecht erscheinende Erfolgsbilanz verzichten – was für ein Parteiprogramm ja eher untypisch ist. Andererseits durften wir aber auch den für die Zukunft notwendigen Reformbedarf nicht als Kritik an unseren bisherigen Leistungen oder Unterlassungen erscheinen lassen« (Schäuble 2000: 30f.).
Für Schäuble wurde das »viel gelobt[e] Zukunftsprogramm« allerdings wieder unglücklich präsentiert, da bei der Vorstellung auf einer Pressekonferenz Nachfragen und Fokus einseitig auf den zwischen CDU und CSU massiv umstrittenen Punkt der Einführung einer möglichen Ökosteuer lagen. Schäuble geht sogar so weit zu sagen, dass einige der Journalisten für diese Frage bewusst durch Mitarbeiter aus dem Bundeskanzleramt »munitioniert« (Schäuble 2000: 33) worden seien. Unabhängig von der Stichhaltigkeit dieses Verdachts ist seine Formulierung ein weiterer Ausweis für die Spannungen und Spaltungen innerhalb der Kernexekutive, die sich unter dem Eindruck der nahen Bundestagswahl vergrößerten.
Dies betraf zum einen die Parteien: Gab es schon innerhalb der CDU erhebliche Diskrepanzen, so bestanden solche auch deutlich mit bzw. zwischen CSU und FDP. Alle Parteien blickten auf die Auswirkungen ihres Verhaltens in der Steuerreformdebatte für ihre Wahlchancen. So stellte sich der Finanzminister als CSU-Parteivorsitzender aus dem Flächenland Bayern anfangs gegen jegliche Überlegungen einer signifikanten Erhöhung der Mineralölsteuer. Zugleich wollte die FDP keinesfalls ihren Ruf als Steuersenkungspartei kompromittieren: »Nahezu alle, auch eher unwichtige von der Koalition zu treffende Entscheidungen mutierten für die FDP zur Nagelprobe auf das liberale Profil« (Schäuble 2000: 22).
Die von CSU und FDP markierten Fronten verringerten jedoch ihrerseits die Einigungschancen mit der SPD. Erst spät gelang es Schäuble, Waigel in Teilen von der Ökosteuer zu überzeugen, doch dann »hatte sich in der FDP bei Fraktionschef Solms und dem Parteivorsitzenden Gerhardt die Überzeugung durchgesetzt, dass eine Fortsetzung der Konfrontation zwischen Koalition und rot-grüner Opposition den Liberalen für die Wahl 1998 die bessere Überlebensperspektive bot als eine teilweise Auflösung von Bundesratsblockade und Reformstillstand« (Schäuble 2000: 24).
Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Steuerreform kein eigenständiges Thema der Sachpolitik mehr, sondern vollends in die machtpolitische Arena hinübergezogen. Die FDP etwa sah hinter dem Erfolg der Reform, und das heißt einer zumindest teilweisen Einigung mit der SPD, den Vorboten zu einer Großen Koalition nach der Bundestagswahl 1998. Helmut Kohl (der in Fortführung seiner langjährigen Überzeugung fest zur FDP und einer Großen Koalition höchst ablehnend gegenüberstand) sah in Wolfgang Schäuble, trotz dessen Bekundungen des Gegenteils, nicht den um Erfolg in der Reform bemühten Fraktionsvorsitzenden, sondern den Konkurrenten, der ihm nach der Bundestagswahl als möglicher Kanzler einer Großen Koalition Amt und Anspruch streitig machen würde.
Schäuble sieht solche internen Spannungen auch als »Ausdruck von innerer Erschöpfung einer Koalition, die in 16 Jahren angesichts schwindender Wahlaussichten müde geworden war« (Schäuble 2000: 34). Das Misstrauen und die »latente Konkurrenz« (Leinemann 2001: 104) zwischen Schäuble und Kohl fanden einen bezeichnenden Höhepunkt in einem Gespräch über die Wahlchancen und einen personellen Wechsel, das beide im April 1998 entzweite (Leinemann 2001: 118).
Wenngleich es durchaus zu Annäherungen in zentralen Streitfragen der Reform gekommen war, so gab es – innerhalb und außerhalb der Koalition – keine parteipolitische Motivation mehr zur Einigung. Lafontaine legte in den Verhandlungen permanent mit neuen Forderungen nach, während die FDP einige Bereiche für grundsätzlich inakzeptabel erklärte und auch Kohl begann, eine rote Linie für die Kompromissfähigkeit der Union zu markieren.
Einige Positionswechsel sind vor dem Hintergrund einer sachorientierten Gestaltung des Reformprozesses kaum nachzuvollziehen. Sie bekommen jedoch Sinn, wenn man das weitere machtpolitische Gelände nachzeichnet, innerhalb dessen die Steuerreform stattfand. Vor diesem Hintergrund wäre es verfehlt, von einer auf die sachpolitische Wirkung der Steuerreform konzentrierten Erfolgskontrolle zu sprechen, für die sich tatsächlich nur wenige Anhaltspunkte finden. Erfolgskontrolle fand statt – allerdings als äußerst sensible Kontrolle der Faktoren, die die Erfolgschancen der unterschiedlichen Akteure mit Blick auf die nächste Bundestagswahl beeinflussen konnten.
Es ist durchaus symptomatisch, dass diese Wahl von mehreren Akteuren auch als Entscheidung über die Reform deklariert wurde. Hier wurde also (zumindest teilweise) genau jenes konkrete Mandat zur Reform gesucht, dessen Vorhandensein zu Beginn des Reformprozesses vieles hätte erleichtern können. Ein in Überzeugungsarbeit gewonnenes politisches Mandat, das sich als erkennbarer Wählerwille in normative Grundlage sowie Auftrag zur Reform umsetzen lässt, kann im Prozess selbst unschätzbare Ressource und Treibstoff der Politik sein und über manche Klippe bzw. Blockade hinweghelfen. Dass sich andererseits die Agenda der Politik nicht als Liste vorhersehbarer Themensetzungen der Regierung oder der Bevölkerung ergibt, fällt unter die bereits genannten Kontingenzen des Politischen. Die Validität der im SPR gebündelten Kriterien kann am Beispiel der gescheiterten Steuerreform auch darin erkannt werden, dass es im Reformprozess nicht zu einer Optimierung, sondern eher zum Auseinanderdriften der strategiefähigen Kernexekutive kam. In den unterschiedlichen Phasen bestand kontinuierlich Unsicherheit über die Sache selbst (Kompetenz), was in einer letztlich nicht durchdringenden Kommunikation resultierte, die mit geringer werdender Durchsetzungsfähigkeit einherging.
Es konnte jedoch auch gezeigt werden, dass es durchaus Anpassungen der Strategie, Versuche der Neuorientierung und -aktivierung gab. Deren Erfolglosigkeit und die nicht erfolgte Realisierung des sachpolitischen Einigungspotenzials zwischen den verschiedenen Akteuren ist durch die geradezu magnetisierende Wirkung des Kraftfelds Bundestagswahl zu erklären, die die einzelnen Positionierungen machtpolitisch ausrichtete. Das richtige Timing von Reformprozessen und die Auswirkungen der Simultaneität paralleler Reformprojekte haben bei der Anwendung des SPR wie bei der Gestaltung erfolgreicher Politik entscheidende Bedeutung.
- Bergmann, Knut. Der Bundestagswahlkampf 1998. Vorgeschichte, Strategie, Ergebnis. Wiesbaden 2002.
- Braakmann, Albert, Norbert Hartmann, Norbert Räth und Wolfgang Strohm. »Revision der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 2005 für den Zeitraum 1991 bis 2004«. Wirtschaft und Statistik 5/ 2005. Hrsg. Statistisches Bundesamt. Wiesbaden 2005. 425 – 462.
- Bundesministerium der Finanzen. »Finanznachrichten vom 20.3.1997«. Bonn 1997a.
- Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.). Reform der Einkommensbesteuerung. Vorschläge der Steuerreform-Kommission vom 22. Januar 1997 (»Petersberger Steuervorschläge«). Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen 61. Bonn 1997b.
- Duckenfield, Mark. »The Goldkrieg: Revaluing the Bundesbank’s Reserves and the Politics of EMU«. German Politics (8) 1 1999. 106 – 130.
- Dyson, Kenneth. »Chancellor Kohl as Strategic Leader: The Case of Economic and Monetary Union«. German Politics (7) 1 1998. 37 – 63.
- Einkommensteuerkommission. Thesen der Einkommensteuer-Kommission zur Steuerfreistellung des Existenzminimums ab 1996 und zur Reform der Einkommensteuer. Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen 55. Bonn 1995.
- Fischer, Thomas, Gregor Peter Schmitz und Michael Seberich. »Die Strategie der Politik«. Die Strategie der Politik. Ergebnisse einer vergleichenden Studie. Hrsg. Thomas Fischer, Gregor Peter Schmitz und Michael Seberich. Gütersloh 2007. 195 – 221.
- Fröhlich, Manuel. Sprache als Instrument politischer Führung. Helmut Kohls Berichte zur Lage der Nation im geteilten Deutschland. München 1997.
- Fröhlich, Manuel. »Sprachstrategien im Wettbewerb um die Macht. Die Haushaltsdebatten in den Wahlkämpfen von 1979 bis 1998«. Aufstieg und Fall von Regierungen. Machterwerb und Machterosionen in westlichen Demokratien. Hrsg. Karl-Rudolf Korte und Gerhard Hirscher. München 2001. 147 – 190.
- Fröhlich, Manuel. »Die Sprache des Wahlkampfs. Argumentationsmuster und Strategien«. Trends der politischen Kommunikation. Beiträge aus Theorie und Praxis. Hrsg. Forum Medien Politik. Münster 2004. 60 – 71.
- Ganghof, Steffen. Wer regiert in der Steuerpolitik? Einkommensteuerreform zwischen internationalem Wettbewerb und nationalen Verteilungskonflikten. Schriften des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung Köln 50. Frankfurt am Main und New York 2004.
- George, Alexander L., und Andrew Bennett. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. Cambridge 2005. Glaab, Manuela. »Strategie und Politik. Das Fallbeispiel Deutschland«. Die Strategie der Politik. Ergebnisse einer vergleichenden Studie. Hrsg. Thomas Fischer, Gregor Peter Schmitz und Michael Seberich. Gütersloh 2007. 67 – 115.
- Gros, Jürgen. Politikgestaltung im Machtdreieck Partei, Fraktion, Regierung. Zum Verhältnis von CDU-Parteiführungsgremien, Unionsfraktion und Bundesregierung 1982 – 1989 an den Beispielen der Finanz-, Deutschland- und Umweltpolitik. Berlin 1998.
- Grunden, Timo. Nach dem Machtwechsel der Politikwechsel? Die Frage der sozialen Gleichheit in christdemokratischer und sozialdemokratischer Steuer- und Haushaltspolitik 1994 – 2002. Duisburger Materialien zur Politik- und Verwaltungswissenschaft 14. Duisburg 2004.
- Heinrich, Gudrun. »Koalitionsverhandlungen und Regierungsbildung auf Bundesebene im Spiegel der Presse«. Zeitschrift für Parlamentsfragen (26) 2 1995. 193 – 203.
- Herzog, Roman. »Aufbruch ins 21. Jahrhundert«. Berliner Rede 26.4.1997. www.bundespraesident.de/Reden-und-Interviews/Re den-Roman-Herzog-,11072.15154/Berliner-Rede-von-Bundesprae si.htm?global.back=/Reden-und-Interviews/-%2c11072%2c6/Re den-Roman-Herzog.htm%3flink%3dbpr_liste (Download 18.11.2007).
- Homeyer, Immo von. »›Große Steuerreform‹ – Wer gewinnt, wer verliert?«. Gegenwartskunde (45) 4 1996. 519 – 529.
- Knoll, Thomas. Das Bonner Bundeskanzleramt. Organisation und Funktion von 1994 – 1999. Wiesbaden 2004.
- Kohl, Helmut. Mein Tagebuch 1998 – 2000. München 2000.
- Korte, Karl-Rudolf. Deutschlandpolitik in Helmut Kohls Kanzlerschaft. Regierungsstil und Entscheidungen 1982 – 1989. Stuttgart 1998.
- Korte, Karl-Rudolf. »Information und Entscheidung. Die Rolle von Machtmaklern im Entscheidungsprozess von Spitzenakteuren«.
- Aus Politik und Zeitgeschichte B43 2003. 32 – 38.
- Korte, Karl-Rudolf, und Manuel Fröhlich. Politik und Regieren in Deutschland. Strukturen, Prozesse, Entscheidungen. 2. Auflage. Paderborn, München, Wien und Zürich. 2006.
- Korte, Karl-Rudolf, und Gerhard Hirscher (Hrsg.). Darstellungspolitik oder Entscheidungspolitik? Über den Wandel von Politikstilen in westlichen Demokratien. Berichte und Studien der Hanns-Seidel-Stiftung 81. München 2000.
- Lafontaine, Oskar. Das Herz schlägt links. München 1999.
- Lambsdorff, Otto Graf. Konzept für eine Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Bonn 1982.
- Langguth, Gerd. Das Innenleben der Macht. Krise und Zukunft der CDU. Berlin 2001.
- Lehmbruch, Gerhard. Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Regelsysteme und Spannungslagen im Institutionengefüge der Bundesrepublik Deutschland. 2. Auflage. Wiesbaden 2002.
- Leinemann, Jürgen. Helmut Kohl. Ein Mann bleibt sich treu. Berlin 2001.
- Mertes, Michael. »Führen, koordinieren, Strippen ziehen: Das Kanzleramt als Kanzlers Amt«. Darstellungspolitik oder Entscheidungspolitik? Über den Wandel von Politikstilen in westlichen Demokratien. Berichte und Studien der Hanns-Seidel-Stiftung 81. Hrsg. KarlRudolf Korte und Gerhard Hirscher. München 2000. 62 – 84.
- Mertes, Michael. »Bundeskanzleramt und Bundespresseamt. Das Informations- und Entscheidungsmanagement der Regierungszentrale«. Information und Entscheidung. Kommunikationsmanagement der politischen Führung. Hrsg. Karl-Rudolf Korte und Gerhard Hirscher. Wiesbaden 2003. 52 – 78.
- Mertes, Michael. »Regierungskommunikation in Deutschland: komplexe Schranken«. Reformen kommunizieren. Herausforderungen an die Politik. Hrsg. Werner Weidenfeld. Gütersloh 2007. 17 – 35.
- Raschke, Joachim, und Ralf Tils. Politische Strategie. Eine Grundlegung. Wiesbaden 2007.
- Renzsch, Wolfgang. »Die große Steuerreform 1998/99. Kein Stilbruch, sondern Koalitionspartner als Vetospieler und Parteien als Mehrebenensysteme. Diskussion eines Beitrags von Reimut Zohlnhöfer in Heft 2 der ZParl«. Zeitschrift für Parlamentsfragen (31) 1 2000. 187 – 191.
- Rosumek, Lars. Die Kanzler und die Medien. Acht Porträts von Adenauer bis Merkel. Frankfurt am Main und New York 2007.
- Schäuble, Wolfgang. »SPD darf Steuerreform nicht verhindern«. Pressemitteilung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Bonn 1997.
- Schäuble, Wolfgang. Und sie bewegt sich doch. Berlin 1998.
- Schäuble, Wolfgang. Mitten im Leben. München 2000.
- SPD (Hrsg.). »Zukunft sichern – Zusammenhalt stärken. Die sozialdemokratische Alternative zur Flickschusterei der Regierung Kohl«. Beschluss des SPD-Präsidiums vom 25. April. Bonn 1996.
- Sturm, Roland. »Die Wende im Stolperschritt – eine finanzpolitische Bilanz«. Bilanz der Ära Kohl. Christlich-liberale Politik 1982 – 1998. Hrsg. Göttrik Wewer. Opladen 1998. 183 – 200.
- Träger, Hendrik. Die Oppositionspartei SPD im Bundesrat. Eine Fallstudienanalyse zur parteipolitischen Nutzung des Bundesrates durch die SPD in den 1950er-Jahren und ein Vergleich mit der Situation in den 1990er-Jahren. Europäische Hochschulschriften 564. Frankfurt am Main u.a. 2008.
- Uldall, Gunnar. Die Steuerwende. Eine neue Einkommensteuer – einfach und gerecht. München 1996.
- Wagschal, Uwe. »Schranken staatlicher Steuerungspolitik. Warum Steuerreformen scheitern können«. ZeS-Arbeitspapier 7/98. Bremen 1998.
- Waigel, Theodor. »Die Erarbeitung der Petersberger Steuervorschläge durch die Steuerreform-Kommission«. Steuerrechtsprechung, Steuergesetz, Steuerreform. Hrsg. Paul Kirchhof, Wolfgang Jakob und Albert Beermann. Köln 1999. 983 – 993.
- Weidenfeld, Werner (Hrsg.). Reformen kommunizieren. Herausforderungen an die Politik. Gütersloh 2007.
- Zohlnhöfer, Reimut. »Die große Steuerreform 1998/99. Ein Lehrstück für Politikentwicklung bei Parteienwettbewerb im Bundesstaat«. Zeitschrift für Parlamentsfragen (30) 2 1999. 326 – 345.
- Zohlnhöfer, Reimut. »Vom Wirtschaftswunder zum kranken Mann Europas? Wirtschaftspolitik seit 1945«. Regieren in der Bundesrepublik Deutschland. Innen- und Außenpolitik seit 1949. Hrsg. Manfred G. Schmidt und Reimut Zohlnhöfer. Wiesbaden 2006. 285 – 313.